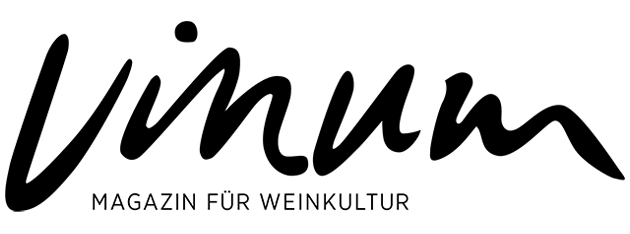Weingut Graf Schönborn im Rheingau trennt sich von Betriebsleiter Barth: Unerlaubte Konzentration?
16.11.2012 - R.KNOLL
DEUTSCHLAND (Hattenheim) - Die Grafen von Schönborn machten sich über Jahrhunderte hinweg einen Namen als kirchliche und politische Würdenträger im süddeutschen Raum und darüber hinaus. Christoph Schönborn ist aktuell Kardinal und Erzbischof von Wien. Sie hatten und haben Verbindung zum gesamten europäischen Hochadel. Ihr Ruf als Besitzer von Weingütern im Rheingau, in Franken und in Portugal ist ausgezeichnet. Aber dennoch bekam der Betrieb in Hattenheim (Rheingau) kürzlich überraschenden „Besuch“ von einer Polizeitruppe, die Akten und Computer beschlagnahmte. Diese Unterlagen werden seitdem von der Staatsanwaltschaft auf spezielle Hinweise überprüft…
Auslöser der Razzia, die auch Hausherr Paul Graf von Schönborn schockte, war eine anonyme Anzeige gegen den Rheingauer Betriebsleiter Peter Barth, dem vorgeworfen wurde, mit einer unerlaubten Kühltechnik Wein konzentriert zu haben. Der Tank, in dem das passiert sein soll, ist nichts Ungewöhnliches. Wer sich im Gebiet umhört, erfährt schnell, dass auch andere Betriebe solche Behältnisse haben, in denen Wein gekühlt wird, um Weinstein auszuscheiden. Eine Konzentration mit Kälte ist dagegen nicht erlaubt, auf diesem Feld sind nur Umkehrosmose und Vakuumverdampfung zugelassen. In Deutschland wurde dieser Technik vor rund zehn Jahren Tür und Tor geöffnet, aber im großen Umfang wird sie nicht angewandt. Denn der dabei praktizierte Entzug von Wasser, der zur Alkoholerhöhung führt, ist durch die von der Klimaerwärmung begünstigten guten Jahrgänge kaum mehr nötig.
Der ehrgeizige und nicht allseits beliebte Betriebsleiter Barth, den der Gault Millau 2009 zum „Gutsverwalter des Jahres“ kürte, erachtete solche Nachhilfe trotz Zugriff auf etliche Toplagen in 50 Hektar aber offenbar für notwendig. Dass er kurz nach dem Auftritt der Polizei seinen Arbeitsvertrag auflösen musste, spricht Bände. „Er hat sich bei mir entschuldigt“, lässt der Graf wissen.
Er selbst fiel aus allen Wolken, als er mit den Vorwürfen konfrontiert wurde. „Ich hatte keine Ahnung und wusste auch nicht, dass bei uns so etwas möglich ist. Bilanzen kann ich lesen, aber von der Kellerwirtschaft habe ich keine Ahnung“. Woher auch, muss er doch ein adeliges Imperium dirigieren, in dem der Weinbau eher eine Nebenrolle spielt. Zum Besitz gehören unter anderem 1600 Hektar Wald und 900 Hektar Landwirtschaft.
Der Graf und sein Umfeld befassen sich derzeit mit Rätselraten. Keiner weiß, ob die Vorwürfe letztlich haltbar bleiben, ob es nur um Miniversuche ging, bei denen Barth ausloten wollte, was mit der Kühltechnik möglich ist oder ob er schon über einige Jahrgänge hinweg im größeren Stil so gearbeitet hat. Theoretisch ist denkbar, dass manches „Erste Gewächs“ der letzten Jahre nicht natürlich gewachsen war. Anhand der Weine lässt sich das offenbar nicht feststellen, weil diese Art der Behandlung keine Spuren hinterlässt. Ein Indiz, dass solche „Hilfestellung“ notwendig war, ist der hausintern schon mal kritisierte, nicht optimale Zustand der Weinberge. Das bestätigt auch Barths fränkischer Kollege Georg Hünnerkopf, der mit ihm vor vier Jahren ebenfalls vom Gault Millau zum „Gutsverwalter des Jahres“ gekürt wurde. „Die Reben des Weingutes Schloss Hallburg auf Volkacher Gemarkungen schauen besser aus.“
Hünnerkopf bekam ebenfalls unerwünschten Besuch, in diesem Fall von der fränkischen Weinkontrolle. Denn im Rheingau wurden 1000 Liter Spätburgunder aus Franken registriert, zu denen die notwendigen Begleitpapiere fehlten. Die Lieferung dieser Partie war allerdings ordnungsgemäß in den Büchern dokumentiert. „Eine lässliche Sünde“, urteilte die Behörde. Was mit dem Frankenwein im Rheingau passieren sollte, ist nicht bekannt. Vielleicht wird sich Peter Barth eines Tages dazu äußern.
Für seinen einstigen Arbeitgeber ging es in den letzten Tagen darum, das „Betriebsleiter-Vakuum“ zu beenden. Denn der Jungwein wartet im Keller auf professionelle Behandlung. Es gibt zwar noch einen Kellermeister und Fachpersonal, aber keinen, der richtig anschaffen kann. Inzwischen holte sich Paul Graf von Schönborn den tatkräftigen, international erfahrenen Önologen Steffen Röll ins Haus, der für eine Übergangsphase die Verantwortung im Keller übernimmt. Er selbst hat den ermittelnden Behörden jede erdenkliche Unterstützung zugesichert und will sämtliche Herstellungsprozesse auf den Prüfstand stellen.
Sollte sich eine größere Dimension des Falles ergeben, wird eine Reaktion des Weinführers Gault Millau spannend sein. Vielleicht wird der 2009er Titel stillschweigend getilgt – nach dem Muster von Radprofi Lance Armstrong, dem sämtlicher Tour de France-Siege aberkannt wurden.
Zurück zur Übersicht