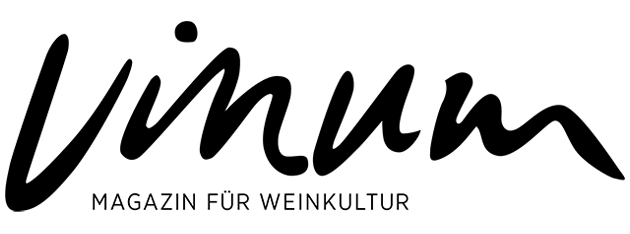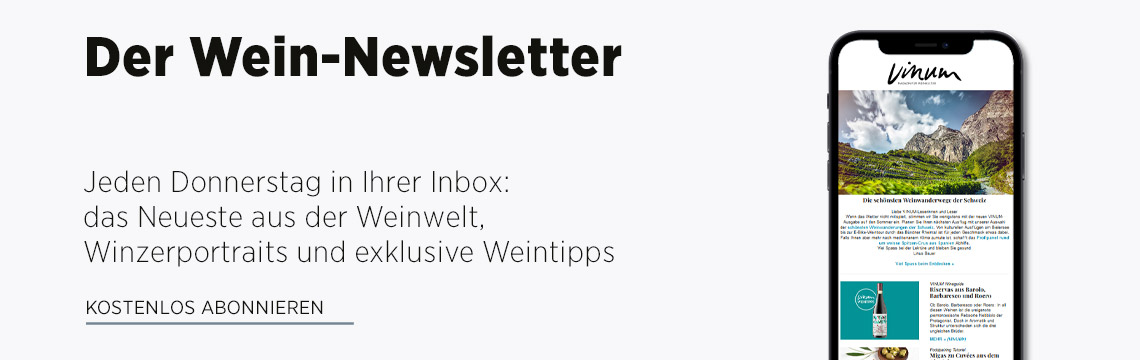«Ich habe immer lieber geschluckt als gespuckt» VINUM-Autor Rolf Bichsel blickt zurück auf 30 Jahre Weinjournalismus
30 Jahre Weinjournalismus
Text und Fotos: Rolf Bichsel

Hallo Freunde. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter. Ich habe heute was ganz Tolles vor. Ich bin echt scharf darauf, mit euch ganz ohne Umwege und lange Reden einen absolut coolen Moment zu teilen. Das heutige Thema heisst: 30 Jahre Weinjournalismus! Let’s dive right in!
Natürlich schickt sich dieser Einstieg so nicht. Es geht hier um ein ernstes Thema in einer seriösen Zeitschrift. Da muss eine Abhandlung doch nach guter Weinjournalistenmanier beginnen. So wie jeder echte Weinbeitrag beginnen sollte: mit den guten alten Römern. «Alea iacta est» könnte ich zum Beispiel murmeln und so meine bei Asterix und Obelix erworbenen, ziemlich ausgekühlten Lateinkenntnisse blossstellen. Dann könnte ich den Kopf in den Treibsand stecken und blind und mit verklemmtem Korkenzieher ein paar weise Sätze mit dem Inhalt, dass Weinjournalismus das Gelbe vom Straussenei sei und über Wein so lange geschrieben werde, wie es Wein gebe, in eben diesen (den Sand) ritzen. Schliesslich könnte ich mit ersterbender Stimme «Quod erat demonstrandum» röcheln (ich denke, ich bin gestrandet) und trotz kreischendem Getriebe den Rückwärtsgang einlegen. Pustekuchen, wenn ich mir diesen Einwand erlauben darf, mein lieber Autor und Anti-Ego (Tönt wie Don Diego. Gleich kommt Zorro angestürmt. Oder Dom Ruinart oder Reinecke Fuchs?). Das kann man auch von Musik oder Rhetorik oder Mathematik oder Gerstensuppe behaupten oder, warum nicht, von Sex, Sea und Sonnencreme. Doch käme auch der nüchternste Schnapser nicht auf die Bieridee, deswegen gleich nach Spa zu wandern oder Sparta zu erobern – will sagen, mit feuchter Feder und scharfem Degen eine neue Mediensparte aus dem alten Holzfass zu fischen. Ich besitze einen Presseausweis: Doch als «(Wein-)Journalisten» habe ich mich nie bezeichnet. Zu viel Respekt vor echten solchen. Ich habe es im besten Fall zum Berufsalkoholiker gebracht.
Weinjournalismus. Kommt dieses Wortgespinst nur mir neuspanisch vor? In Frankreich nennt man uns «critiques» oder «chroniqueurs». Auf Englisch werden wir «Wine Writer» geheissen. Nur die deutsche Sprache hat den Weinjournalisten erdacht und erschaffen. Ich denke, der Begriff hat sich als Kurzform und Resultat der Formel «Weinfachmann + Journalist» im Sprachgebrauch eingenistet. Seltsamerweise ist gerade jemand, der so bezeichnet wird, in den meisten Fällen weder das eine noch das andere, noch seltener beides, sondern wie ich ein Kreuz-und-Quereinsteiger. Verstehen wir uns richtig. Das hat nichts mit Qualität oder Integrität oder anderen menschlichen Werten zu tun. Ich stelle nicht den Inhalt in Frage, sondern die Appellation, die obskure Scheinehe zweier Wörter, die, wenn man sie auf Herz und Leber prüft, in den meisten Fällen Puff macht und klaglos verduftet.
«Journalismus (abgeleitet von französisch ‹journal›) bezeichnet die periodische publizistische Arbeit von Journalisten bei der Presse, in Online-Medien oder im Rundfunk mit dem Ziel, Öffentlichkeit herzustellen und diese mit gesellschaftlich relevanten Informationen zu versorgen», weiss Wikipedia. Okay. Ein Journalist versorgt die Öffentlichkeit mit gesellschaftlich relevanten Informationen. Das ist gut. Das gefällt mir. Das wirft freilich auch die Frage auf, ob etwas am Wein «gesellschaftlich relevant» sei. Hmm. Vor 30 Jahren hätte ich die Frage eifrig bejaht. Heute bin ich mir da nicht mehr so sicher. Nicht unbedingt, weil ich mich verändert habe. Nein, Gesellschaft und Umfeld sind, so will mir scheinen, so ganz anders geworden, nicht wahr, Herr Settembrini? Geplagter, reaktionärer, geknebelter, gefesselter, verklemmter. Das hat nur beschränkt mit der Tatsache zu tun, das alles vor die Hunde geht in unserem Schillernden und Räubernden Kastratenjahrhundert. Vor 50 Jahren war das auch schon so, wir taten nur, als würden wir es nicht bemerken. Nein, wir haben noch ganz andere Sorgen. Nicht nur Sintfluten schwappen über unseren Köpfen zusammen, sondern auch ein wahrer Tsunami an Informationen, die meist gar keine sind (Kann es Fake News geben? Natürlich nicht! News, die fake sind, sind keine News), wir ertragen freiwillig und auf Knien rutschend die Knute der Social Media (die weder Medien sind noch sozial), himmeln mit feuchten Hundeaugen deren Einflussnehmer an (Influenceurs heissen die auf Französisch, das tönt nicht nur so, die sind auch so ansteckend wie Influenza) und verschwenden den letzten Funken Vitalität virtuell damit, den lieben langen Tag Softwareupdates zu ertragen. Viel Raum zum Ausleben echter Weinkultur, so wie ich sie verstehe, bleibt da wirklich nicht. Wein, auf seine soziale Funktion reduziert, ist weder Nahrungsmittel noch Spekulationsobjekt. Zum digitalen Unikat mit nicht ersetzbarer Wertmarke eignet er sich kaum. Wein ist konkret, nicht abstrakt, ist Kulturgut der Menschheit, wie Nabokovs «Lolita», Miles Davis‘ «Kind of Blue» oder die Mayonnaise. Wein ist der beste Vorwand, jeden Tag frohgemut ein Stück Dasein neu zu erforschen und schmeckt erst noch ganz köstlich. Wein ist ein Fernrohr, das uns die Sterne näherbringt, ein Prisma, an dem die Welt sich bricht. So. Damit ist es heraus. Doch bevor der Zensor zur Schere greift und die Inquisition den Scheiterhaufen schichtet, bevor Stinkbomben platzen und Todesdrohungen aus der Inbox zwitschern, folgt hier gleich ein kurzes, aber wichtiges Bekenntnis: Ja, die Optik dieses Beitrags ist einseitig und subjektiv und irrelevant und blasiert und subversiv. Ja, was hier steht, basiert einzig und allein auf meiner häretischen Uneinsichtigkeit. Niemand muss diese teilen. Ich werde auch nicht wie Bertholds Galileo «Und sie bewegt sich doch» radebrechen, kaum dreht man mir den Rücken. Natürlich habe ich immer recht. Doch ich gestehe das auch meinen Gegnern zu. Gute Feinde stehen mir näher als schlechte Freunde.

Schmecken mit Schrecken hat Dreck am Stecken
Meine offizielle «Karriere» (noch so ein Ausdruck, tönt wie Löcher in den Zähnen) als Weinschreiberling begann vor 35 Jahren. Sie wurde mir als jungem Bär aufgebrummt, hat mich alt werden und in Unehren ergrauen lassen. Aus dem Spiegel glotzt mir ein Silberfuchs entgegen, der trotz stumpfem Degen das Gänsestehlen nicht lassen kann. (Womit das nur mir verständliche «Zorro der Fuchs»-Bild wohl endgültig ausgereizt wäre). Auf den Wein an und Pfirsich bin ich als frühreifer Spätpubertierender gestossen, aus purer Freude am Kult des Schmeckens, der nach und nach zu einer Kultur des Genusses mutierte, die ich mir nicht ganz mühelos anzueignen suchte, nicht zuletzt mit gerade 22 Jahren als Kochschullehrer mit Weinaffinität beim damals wichtigsten Weinhändler des Landes, noch so ein linker Job, der mich gefunden hat, ohne dass ich das geringste dazu beigetragen hätte. Das Drama meines Lebens lässt sich auf einen Satz reduzieren: Ich habe nie gelernt, nein zu sagen, und zerstreut übersehen, dass ich das zu bereuen habe.
Zum Über-Wein-Schreiben bin ich wirklich gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Durch jede Menge Zufälle und eine schicksalshafte Begegnung. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass ich mich zuvor mit Musik herumgeschlagen und sogar ein vergilbtes, staatlich abgesegnetes Klavierdiplom in irgendeiner verstaubten Lade liegen habe, das einzige Papier, das mir (ausser dem Führerschein) offiziell eine halbwegs nützliche Fähigkeit bescheinigt. Ich habe mir nie viel aus Diplomen gemacht. Meine Schule war die Schule des Lebens. Da konnte ich allerdings auf die besten Lehrer zählen. Dass ich meinen Platz im Schatten so quasi in der Lotterie gewonnen habe, weiss ich nur zu gut.
Dazu bewogen, eine unsichere Zukunft gegen die andere einzutauschen, wurde ich mit einem Argument, dem einfach nicht beizukommen war: «Auf der VINUM-Bühne warten ein paar 100 000 interessierte Leser auf dich. Wenn du trotzdem dein Leben in rauchigen Clubs verbringen willst (ja, damals gab es das noch, Clubs mit echtem, ungesundem Zigarettenrauch, so unendlich erträglicher als unsere im falschen Moment aufflackernden, in der falschen Tonart flötenden Debil-Monofone), mit hundert gelangweilten Leuten, denen es egal ist, ob du mit den Händen oder den Füssen klimperst, bist du selber schuld.»
Autsch. Der Hieb sass und traf genau da, wo es schmerzte. Ich ging natürlich schon in der ersten Runde in die Knie und unterschrieb nach technischem k.o. in der zweiten. Zwölf Monate später las ich nicht ohne Erstaunen ein Editorial, in dem stand, dass ich künftig Chefredaktor sei. Tönt besser als es war. Brachte mir rasch abnehmenden Stolz ein und rasant zunehmenden Ärger. Für hunderttausende geschrieben habe ich natürlich trotzdem nie, sondern bin instinktiv bei der alten Bühnenregel geblieben, die besagt, dass es besser sei, für die eine begeisterte Dame in der dritten Reihe zu spielen, die immer als Erste lache, als für eine unübersichtliche und unfassbare anonyme Menge. Ich kenne nur einen Leser: meinen. Aber für den nehme ich alles in Kauf. Schicksal, Geschmack für Abenteuer, Zeitgeist und eine echte Vaterfigur haben einen «Karrieresprung» möglich gemacht. Doch im Herzen, Bauch und Hinterkopf bin ich bis heute geblieben, was ich schon immer war: ein mässig begabter, leicht autistischer Strassenmusikant, ein verlauster Clown ohne Zirkuswagen, ein etwas gar selbstverliebter Till Eulenspiegel, der ewig nach seinen Narrenglöckchen sucht, ein zerstreuter Alleinunterhalter, der stets überhört, was sein Publikum hören will.
Ich bekenne, ich habe getrunken
«Grosser Wein schien als einziges Produkt landwirtschaftlicher Herkunft die neukeynesianische These zu widerlegen, dass am schnellsten und erfolgreichsten die Konkurrenz ausschalte, wer immer billiger produziere, sofern er dies mit ‹immer mehr› kompensiere!»
In den 1980er Jahren begann Wein weltweit zu boomen, und in den 1990er swingte, poppte und rockte er. Nach gut hundert Jahren, während denen leicht angefaulter Rebensaft irgendwo zwischen billigem Arbeitergetränk und verstaubter Nostalgie anzusiedeln war und in vergammelten Eichenfässern und verwitterten Betontanks traurig von guten alten Zeiten träumte und in denen es davon so wenig gab, dass die «Grande Nation» praktisch allein die Szene des «Grand Vin» beherrschte oder jedenfalls so tat, wurde urplötzlich alles anders. Kalifornien machte Bordeaux Beine, Italien erwachte aus dem Winterschlaf, Deutschland entdeckte den Qualitätswein wieder und wurde sich der Tatsache bewusst, dass auch Rot auf seine Flagge passte, und die Schweiz kam fast allein auf die Idee, dass der Maghreb ja eigentlich kein Walliser oder Waadtländer Anbaugebiet sei und es sogar mitten in den Alpen grosse Terroirs gebe.
Die Weltspindel schien immer schneller um ihre Achse zu rotieren, doch der Wein, ja, ausgerechnet der Wein, dieses absolute Symbol von Langsamkeit und Langlebigkeit und Sesshaftigkeit und Arbeitsteilung wurde zum Yuppie-Statussymbol erkoren wie vor ihm der Bonsai oder die John-Lennon-Brille und nach ihm Blackberry oder Macbook Pro. Dass der Scoop, sich wie ein Lauffeuer ausbreitend, sich beim näheren Hinsehen auf die simple Feststellung reduzieren liess, Qualität sei rentabler als Menge, schien niemand zu stören. Die Preise stiegen, Spitzenwein warf in einem einzigen Jahrgang Renditen ab, von denen Winzer einst generationenlang träumten, und bald zählte sich auch der vorletzte weinende Hinterwäldler zur rasch wachsenden Gruppe der Qualitätspioniere. Dass der Theorie nicht immer gleich die Praxis folgte, liegt auf der Hand. Die Botschaft der Qualität mag 30 Jahre später echt ausgelutscht anmuten: Sie war und ist letztlich origineller, als sie tönt. Denn Spitzenwein ist bis heute das wohl einzige Produkt landwirtschaftlicher Herkunft, das erfolgreich dem neukeynesianischen Modell trotzte, dessen These sich mehr und mehr darauf zu beschränken schien, die Konkurrenz dadurch zu eliminieren, dass man «immer billiger» produzierte, was man dann mit «immer mehr» kompensierte. Wir bezahlen nicht erst heute Kopfgeld für die Folgen skrupelloser Wirtschaftstheorie.
Die «Öffentlichkeit», die sich für Wein interessierte, wurde laufend breiter und damit auch die Palette der angebotenen Weine (oder umgekehrt: Ich weiss bis heute nicht so recht, ob das Huhn vor dem Spiegelei gebraten wird oder danach), die immer besser wurde. Doch an Unterschieden bereichern kann sich nur, wer diese auch wahrnimmt. Trinken ist ein Überlebensakt, Geniessen ein kultureller. Kultur hat mit Wissen und Erfahrung zu tun, mit Leidenschaft und Freude, «Excitement» würde man auf Englisch sagen. Nach gut hundert Jahren Existenz als fixe Idee, als unbewiesenes Theorem, wurde Spitzenwein plötzlich wieder real und schaffte den Sprung zurück in die Charts der Medien, besonders im Print. Nicht nur, weil grosse Weinbaubetriebe plötzlich die Mittel hatten, grosszügig in Werbung zu investieren, sondern auch und gerade, weil immer mehr Leser echtes Interesse an den Axiomen dieser wiedererwachenden, so herrlich unexakten und so unsagbar menschlichen Wissenschaft zeigten. So gut wie alle Tages- und Wochenzeitungen führten eine Weinkolumne ein: Ich habe zusätzlich zu meiner VINUM-Arbeit in meinen ersten zwei, drei Jahren als unerfahrenes Greenhorn mehr solche verfasst als in meiner ganzen späteren Laufbahn zusammen. «Weinjournalisten» waren plötzlich echt gesucht – weil es keine «echten» Weinjournalisten gab. So ganz reibungslos ging der Umstieg für mich trotzdem nicht vonstatten.
POSITIV:
Die Leute, mit denen ich es in den nächsten drei Jahrzehnten zu tun kriegen sollte, ob in der Medienwelt oder im Wein, schienen alle ähnlich verrückt zu sein wie ich und assimilierten mich rasch als einen der ihren. Alle spürten sie frischen Wind unter den Ikarusflügeln und griffen zu den Sternen. Die einen rangen der Sonne reife Trauben ab, die anderen kneteten daraus geschickt feuchte Träume. Wer eine gute Idee hatte, setzte sie um – manchmal sogar mit Erfolg. Wein wurde zum Tummelfeld von Ein- Um- UND Aussteigern, von Linkspassivisten UND abgehalfterten Aristokraten, von Businesspartnern UND durch und durch bürgerlichen Söhnen, die nicht mehr nur zum Wein fanden, weil sie für nichts anderes zu gebrauchen waren, sondern aus echter, neu erwachter Leidenschaft. Als etwas später sogar die Töchter zu dieser männerdominierten Unterwelt zugelassen wurden – oder besser, sich selber zuliessen, mit viel Einsatz und Talent –, liess ich endgültig von meiner alten Sommerliebe ab, sperrte Michael Jackson & Co ins Klosett und killte die letzten Reste Notendurst mit reichlich Champagne Jacquesson.
NEGATIV:
Ich habe immer lieber geschluckt und genossen (mit Mass, versteht sich, ich vertrage Alkohol schlecht) als gespuckt und verkostet. Verkosten. Der Begriff allein bringt mich auf die Palme, treibt mir die Schamröte zu Berge, die gesträubten Nackenhaare auf die Zähne und die Hühneraugen in die Stirn oder so ähnlich. Wie kann man nur etwas so unendlich Schmackhaftes und Belebendes und Berauschendes und Inspirierendes wie grossen Wein mit einem so spotthässlichen Ausdruck in Verbindung bringen, der riecht wie Hundekot und röhrt wie eine Maschinengewehrsalve oder schlimmer, wie ein Daaaalek, der «eeeexterminate» rasselt, nicht wahr Dr. Wer? Zerkostet, ihr schnäbelrasselnden Berserker, aber lasst mich dabei aus dem Spiel.
Ich habe mir die Technik des Degustierens (tönt auch nicht besser, erinnert mich gleich wieder an die alten Römer) allerdings dennoch aneignen müssen. Zum mit allen Rebensäften gewaschenen und doch nie sauberen Weinkoster (das ist etwas besser, dehnt man das O, unterdrückt das T, tönt das fast wie Liebkosen oder Rosen) wurde ich, nachdem ich A) einsehen musste, dass die meisten damals aktiven es auch nicht besser wussten als ich, diese aber B) ausgerechnet die Weine in die Pfanne hauten, die ich am liebsten mochte. Für mich als erklärten Dialektiker brauchte es da dringend eine Antithese, oder zumindest einen winzigen Dorn in der Nase des Apostels, der eben daran war, das neue Weintestament zu verfassen, dessen Nutzniesser nur darauf warteten, ihn zum allmächtigen Weinpapst zu salben.
Weil ich meine calvinistisch-protestantische Herkunft nur schwer verleugnen kann, habe ich Schnüffeln und Kauen und gekonnt Durch-die-Zahnlücke-Speien folglich ganz ernsthaft studiert und erlernt und geübt und verfeinert, zuerst an zwei Weinfachschulen, die aus mir erst einmal ein fehlerschnüffelndes Trüffelschwein machten, doch rasch wieder am lebenden Objekt, was glücklicherweise direkt zur Erkenntnis führte, dass selbst die unwürdigste Weinseele ihre guten Momente hatte. Der Champagner, den ich, glücklich darüber, nach einer arbeitsreichen, echt aufreibenden Woche in Zürich für ein paar geruhsame Weihnachtstage nach Bordeaux zu Frau und neugeborenem Sohn zurückkehren zu dürfen, an einem 24. Dezember über eingeschneiten Alpengipfeln vor tiefblauem Himmel in 10 000 Metern Höhe so vergnügt und dankbar aus dem Plastikbecher schlürfte, als wär’s der letzte Krug vor dem Brunnenuntergang, entpuppte sich auf meine pochende Nachfrage hin als genau die Cuvée, der ich nur ein paar Tage zuvor grosszügig ein «fast ungeniessbar» attestiert hatte. Das hat – Crossair sei Dank – meine Weinsicht für immer verändert. Denn mit der Technik der Weinprobe ist es wie mit der Technik des Klavierspielens. Eine gute pianistische Technik ist unerlässlich, entscheidet aber weder darüber, wie gut ein Stück gerät oder wozu es dient, noch darüber, wie es beim Zuhörer ankommt. Es braucht auch so etwas wie Gefühl.
Ich gebe aber gerne zu, dass auch das Trüffelschwein seinen Nutzen hatte. Nicht alles war Gold, was da plötzlich so übereifrig weinte. Die Qualitätsrevolution kannte auch Rohrkrepierer. Das Resultat meiner ersten Gaumen-und- Nasen-Reise quer durch alle Weine der Côtes du Rhône war ernüchternd (im wahrsten Sinn des Wortes): Von rund tausend Weinen schafften keine 200 die Hürde fehlerlos. Als Weintester spielte man damals wohl oder übel die Rolle eines konsumentenschützenden Vorschmeckers im Dienste der weintrinkenden Menschheit. Lange hat das Gott sei Dank nicht gedauert. Zehn Jahre später gewann ein virtuelles Schnüffeldiplom, wer den technisch zwar einwandfreien, aber absolut untrinkbaren Wertanlagenwein (der seinen Wert nur behält, wenn er nicht umgelegt wird) vom Genusswein unterscheiden konnte. Auch das hat sich mittlerweile von selbst erledigt. Seit zu neugierige Weinspekulanten, die es doch nicht lassen konnten, ein paar Buddeln den Hals zu brechen, gemerkt haben, dass sie doch lieber Rosé mögen, sind grosse Rotweine wieder trinkiger geworden. Die eben noch so modische Eiche wird zum Alteisen geworfen (wo sie natürlich nichts zu suchen hat: Eiche ist schon recht, wie viel davon und wozu ist die Frage). Reine Fruchtigkeit und fruchtige Reinheit liegen im Trend, seit sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass die Traubenbeere eine Beere ist und der Korkenzieher nicht nur zur Zierde da, und in absehbarer Zeit wird sich die Aufgabe meiner künftigen Berufskollegen hoffentlich darauf beschränken, emanzipierten und mündig gewordenen Geniessern dabei zu helfen, selber darüber entscheiden zu können, was ihnen mundet. Dass ich mein tägliches Schöppchen Haut-Bailly dann längst in anderen Gefilden geniessen werde, akzeptiere ich ganz ohne Bitterkeit. Wein wird dann wieder, was er sein sollte und letztlich immer war: Die wichtigste Nebensache der Welt. Mit Betonung auf Nebensache.
Geschichten hat er dennoch eine stolze Menge geschrieben und manchmal sogar Geschichte gemacht, und die gleicht einer ewigen Achterbahn. Da geht es immer mal wieder rauf und mal runter. Als Wahrheitsdroge funktionert Wein als eine Art Frühwarnsystem und ist folglich per Definition azyklisch. Nach Jahren finsterster Holzdiktatur segeln wir – dies nur als Beispiel – endlich erneut im fruchtigen Aufwind wiedergewonnener Trinkerfreiheit. Es liegt allein an uns, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Vielleicht, indem wir nach den Neukeynesianern auch die Neoreaktionären friedlich ignorieren, so ganz nach dem Motto: Stell dir vor, es gibt Faschingsmus und niemand hat einen Löffel.
Auf die Medienwelt bezogen wurde die Renaissance der Weinkultur von zwei Kasten begleitet, die im Grunde genommen wenig verband. Da waren einmal echte Weinautoren wie Hugh Johnson, die für unsinnige Verkostungsmarathone nicht viel übrig hatten, aber ihr eigentliches Handwerk verstanden und sich vorweg für Kultur, Geographie, Philosophie und die Geschichte des Weins interessierten. Journalisten im eigentlichen Sinn des Wortes waren sie vielleicht nicht, doch sie vermittelten zumindest etwas vom Umgang mit journalistischen Techniken – Recherche, Quellenvergleiche, Bild, Titel, Quote und Text. Damit beeinflussten sie positiv die Widerauferstehung der weinschreibenden Zunft. Doch dann kam Robert Parker und führte die Hundert-Punkte-Skala ein. Plötzlich wollte jeder Weinpapst werden. Nur ich schien das nicht wahrhaben zu wollen (protestantische Erziehung und so) – noch so ein Fehler, den ich bis heute nicht bereue.
Als Adept der ersten Kaste feilte ich hingegen beflissen an meiner Sprache. Selbst eine kurze Weinnotiz sollte swingen und klingen wie ein Gedicht von Ernst Jandl. Natürlich ging (auch) das schief. Ich bin doppelt und dreifach das, was Dürrenmatt (oder war es Friedrich Glauser?) als «Sprachheimatloser» bezeichnete. Ich lese oft und viel Englisch, spreche im Alltag Französisch und schreibe fast ausschliesslich Deutsch. Meine Muttersprache hat längst ausgedient: Für Berner Mundart ist nicht einmal in einer Randspalte Platz. Vielleicht gehe ich darum mit Wörtern um wie mit Klangbausteinen, die sich dem Satzrhythmus unterordnen. Ich mag Vielstimmigkeit und Kontrapunkte und habe so instinktiv wie erfolglos versucht, Inhalte zu vermitteln, wie ein Glas Wein Inhalte vermittelt: als vergnügliches Rätsel für Bauch, Herz und Gaumen, das mehrere Lösungen kennt und fesselnd bleibt, weil jede solche neue Fragen stellt («Questions are exciting, answers boring», sagt Hans Zimmer). Ich wollte Spass servieren, allenfalls mit ein paar Denkanstössen abgeschmeckt. Verstanden werden wollt ich nicht. Als platte Entschuldigung mache ich geltend, dass ich Schreiben von Bach, Frank Zappa, Debussy, (Charlie) Parker oder der linken Hand von Ahmad Jamal gelernt habe. Natürlich schwimme ich auch im Meer der Weltliteratur, meist auf dem Rücken und gegen den Strom, von zwei Dutzend anderen Neigungen gar nicht zu sprechen. Die Liste meiner Lieblingsautoren ist endlos und reicht von Hergé, Brian K. Vaughan oder Fred Vargas über Grass oder Joyce bis hin zu Romain Rolland, Pablo Neruda oder Vita Sackville-West. Neugierde und Wissensdurst sind nicht Laster, sondern Pflicht. Wer nur von Wein etwas versteht, versteht auch davon nichts. Das gilt natürlich auch für jede andere Materie, inklusive Gartenbau und Ikebana.

Eine Zeitschrift ist eine Zeitschrift ist eine Zeitschrift
Eine der vielen verrückten Ideen der VINUM-Gründerväter war, die Zeitschrift um eine Flasche zu wickeln und als waschechte Flaschenpost wie früher per Austräger (oder mutigen Paper Girls?) vor der Haustür des Abonnenten landen zu lassen. Ausschlaggebend war der Punkt, dass Wein nur schwer in Sprache zu fassen sei. Sie hatten natürlich nicht Unrecht, waren sie doch mit einem Jargon gross geworden, der Weine mit Schenkeln und Busen versah, nach Hasenbauch duften und tranige Tränen vergiessen liess. Dass ein Bild mehr sagt als tausend Worte, steht kaum zur Debatte. Doch damit ist nicht Sprache gemeint, die sich krauser sexistischer Bilder bedient. Gemeint ist echte Bildsprache, sind Bilder, die sprechen können. Ich musste mich Jahre mit Autoren herumschlagen, die eine Zeitschrift mit einem Telefonbuch verwechselten. Seine Aufgabe erfüllt der Zeitschriftenmacher, der Content mit Pfiff vermittelt, sich dabei eines ausgewogenen Mix aller einschlägigen Stilmittel bedient und Form und Inhalt friedlich koexistieren lässt. Ich folge seit Jahrzehnten einer simplen Regel: Am Anfang steht das Bild, darum bin ich Fotograf geworden. Dann kommt das Layout. Legenden, Lead, Quotes und Titel folgen. Der Haupttext wird zum Schluss eingepasst. Die einzige Ausnahme, die ich mir je erlaubt habe, ist vorliegender Text, aber auch nur, um damit die Regel endgültig in Marmor zu meisseln.
Eine (Fach-)Zeitschrift ist wie eine gute Assemblage oder eine vielstimmige Orchesterpartitur: Die Summe ist besser als ihre Elemente. Isoliert betrachtet mag jeder Part etwas fade wirken. Doch gemeinsam ergeben sie eine harmonische Symbiose. Die Zeitschrift ist kein Medium von gestern, wenn sie sich an eine einfache Regel hält und eine Zeitschrift bleibt. Fernsehen hat dem Radio nur darum nicht das Wasser abgegraben, weil Radio mit der Zeit gegangen und Radio geblieben ist. Ein Medium hat seine Berechtigung genau so lange, wie es seine Berechtigung verdient. Wer eine Zeitschrift lesen will, will eine Zeitschrift lesen, nicht einen als Zeitschrift geschminkten Youtube Channel. Eine Zeitschrift ist eine Zeitschrift ist eine Zeitschrift, mit Betonung auf «Zeit», nicht ein «Short» von zehn Sekunden mit viel nackter Haut und langen Beinen. Die Zeitschrift wird weiter mit Erfolg publiziert werden und vielleicht gar eine Renaissance erleben, so wie aktuell die 1980er Jahre, Deep Purple oder analoge Modularsynthesizer, wenn sie sich auf ihre wahren Werte und Möglichkeiten besinnt. Als Newsmedia hat sie keine Chance – nie eine gehabt. Doch zum Vertiefen von Inhalten während eines Stromausfalls auf der Luftmatratze schlägt sie jedes andere Medium.
Wer nicht trinkt wie ich, ist ein Kamel
Vorwärts zu echten Werten wird sich auch die Weinwelt bewegen müssen, will sie als Kulturform überleben. Sie wird auch morgen noch Botschafter brauchen – Vermittler, die geduldig versuchen, Interessierten das ganze Spektrum des Weins näherzubringen, egal, mit welchen medialen Mitteln. Wer sich zum ersten Mal für (Wein-)Kultur interessiert, steht einsam und allein im Dunkeln. Ein einziger gezielter Schritt trennt ihn vom Licht, doch das weiss er nicht. Er braucht eine mitfühlende Seele, die ihn bei der Hand nimmt und ihn sanft, aber bestimmt auf den richtigen Kurs bringt. Sobald er ans Licht tritt, kann er selber entscheiden, wohin er sich wenden will. Jeder Weinautor soll Seele zeigen, statt in der vollkommen unsinnigen, unnützen und kontraproduktiven Rolle als allwissende Wein-Koryphäe zu erstarren, die mit dem Rohrstock auf das Katheder klopft und mit roter Kreide auf die pechschwarze Tafel kritzelt: «Wer nicht so trinkt wie ich, ist ein Kamel.» Wein ist etwas, was man brüderlich teilt. Wein ist horizontal, nicht vertikal. Es macht einfach keinen Sinn (hat nie einen gemacht), ausschliesslich darum höchstbewertete Rebensäfte, die man eigentlich gar nicht mag, im Keller zu versenken, um sich damit vor Freunden und Bekannten zu brüsten, oder schlimmer noch, um ihnen vorgaukeln zu können, wie wenig diese von Wein verstünden. Eine erfüllte Existenz kennt sinnlichere Werte.
Ein Spaziergang durch den nach einem Hauch Ewigkeit duftenden Nadelwald nach einem Regenfall. Ein paar aufmunternde Worte, an ein Eichhörnchen gerichtet, das eben ein paar Nüsse in die Baumhöhle rollt. Der frisch gepflückte Wildblumenstrauss in der schartigen Karaffe, die sich nicht ohne Wehmut an den Duft all der geheimnisvollen Herrlichkeiten erinnert, die sie in ihrem prallen Bauch ausgetragen hat, bevor sie als Vase endete. Die verstaubte Flasche im Keller, die 1001 Geschichten erzählt. Die letzten eitlen Strahlen der untergehenden Sonne, die auf den weiten Tulpenkelch treffen und das nach Rosen und Kirschen und Leder und Zeder duftende Elixier, das er hütet, in einen geheimnisvoll funkelnden Rubin verwandeln. Der einmalige, unvergessliche Augenblick, wenn das letzte nachlässig in den Kamin geworfene Eichenscheit aufflackert und Funken wirft und einen Rest wohlige Wärme verbreitet, während Monks «Round Midnight» auf dem imaginären Plattenteller dreht oder Denise Stoudmires unnachahmliches «Faith» mit Cory Henry an der Hammondorgel, und du der Liebsten einen zärtlichen Gutenachtkuss auf die Stirne hauchst und ihr ins Ohr flüsterst: «Heute wäre ein guter Tag zum Sterben, denn heute habe ich gelebt.»
Weinpracht versus Notenschlacht

1989 nahm ich erstmals ganz offiziell an einer Bordeaux-Primeurverkostung teil. Das Grüppchen, das sich durch rund 120 Muster grosser Bordeaux schnüffelte, bestand aus rund 15 Personen. Darunter die britische Elite – Serena Sutcliffe, David Peppercorn, Michel Broadbent –, Pierre Crisol und Jacques Dupont, zwei Jungstars aus Frankreich, die eben im Namen von Gault & Millau Furore machten, oder Michel Dovaz, der Genfer, der für die Pariser Konkurrenz tätig war. Eingeschüchtert von so viel Prominenz versteckte ich mich hinter dem breiten Rücken eines mir unbekannten Mannes, der sich plötzlich umdrehte, mir die Hand hinstreckte und sagte: «Hello, ich bin Robert Parker.» Es war das letzte Mal, dass Bob Parker an der offiziellen Primeurwoche teilnahm. Aus heutiger Sicht kann ich ihm das nicht verübeln. Ein paar Jahre später klinkten auch wir uns aus dem offiziellen Primeurrummel aus, dessen Teilnehmerzahl auf mehrere tausend angewachsen waren. Auch die Zahl der zur Probe angestellten Muster stieg ins Unendliche. Vor 30 Jahren kannte Bordeaux, wer 150 Marken kannte, von denen 50 zur Spitzengruppe zählten. Heute sind es mindestens zehnmal mehr, und das gilt auch für alle anderen Weinregionen der Welt .
Mit der ins Unendliche anwachsenden Anzahl interessanter Weine ist auch und ganz objektiv die Qualität der Weine gestiegen. Technisch mangelhafte Weine werden immer seltener, und das soll auch so sein. Wein landet schliesslich ab und wann doch im Magen. Ich sehe nicht ein, warum für diesen in puncto Hygiene, Reinheit etc. andere Regeln gelten sollten als für – sagen wir – Coca-Cola. Das heisst aber auch, dass es immer weniger Sinn hat, unter den vielen objektiv erstklassigen Weinen subjektiv einen absolut besten erküren zu wollen. Davon profitiert nicht der Geniesser, sondern nur mehr der Spekulant.
Weder Robert Parker noch sonst ein Kritiker haben die Weinpunkterei erfunden. Die Weintechniker begannen damit. In deren 20-Punkte-Skala (basierend auf der Notengebung des französischen Schulsystems) dient eine Hälfte (0 bis 10) dazu, den Fehlergrad festzuhalten und die andere (10 bis 20) die objektive technische Qualität. Wir Weinschreiber hingegen vermischen andauernd echt subjektive Kriterien (Stil, Harmonie, Beschreibung der Aromen unter Verwendung von Analogien) mit vermeintlich objektiven (Alkoholgehalt, Länge etc.), die meist auch keine solchen sind, und krönen alles mit einer Note, die ebenfalls Objektivität suggeriert und doch völlig subjektiv ist. Und errechnen dann möglichst noch einen Durchschnittswert. Mich erinnert das an Amazon-Buchbesprechungen. Kleists «Michael Kohlhaas» erhält die Note 4,4 /5. Doch sechs der rund 160 Leser haben dem Werk nur 1 oder 2 Punkte gegeben, nach welchen Kriterien auch immer. Selbst wenn das 160 Leser getan hätten: Ein Klassiker der deutschen Literatur bliebe «Michael Kohlhaas» dennoch. Bemängelte der eine Inhalt und Schreibe («Kleist kommt von Kleister») fand der andere, die fragliche Ausgabe sei unsauber redigiert. Der eine wertete nach klar subjektiven Kriterien, der andere nach vermeintlichen oder echten objektiven. Was aber, wenn dem zweiten Leser ganz einfach die Tatsache nicht gefiel, dass der Lektor der Urausgabe folgte, nicht den Regeln der aktuellen Rechtschreibung, das heisst, ganz einfach Kleists Schreibweise respektierte (im Wein würde man wohl von «Terroir» sprechen), der Leser dies aber nicht wusste und jene nicht kannte?
Fazit: Eine Note ist eine Abkürzung, ein einfaches, universell verständliches Wertsymbol, das den Eindruck auf einen knappen Nenner bringt, den ein Wein in einem bestimmten Moment seiner Existenz auf einen bestimmten Weinprüfer macht, der damit seine persönlichen, teils objektiven, teils subjektiven Kriterien ausdrückt. Die Notiz und weitere Angaben wie Trinkreife dienen dazu, diese Abkürzung besser zu verstehen. Das Ganze kann mit einer Filmkritik verglichen werden: Mehrere Kritiker drücken ihre Meinung aus, sind aber selten gleicher Meinung und entscheiden noch seltener darüber, ob ein Werk für immer in die Geschichte eingehen oder rasch in Vergessenheit geraten wird. Der Kinogänger orientiert sich daran, muss aber schlussendlich selber entscheiden, welchen Film er sich anschauen will.