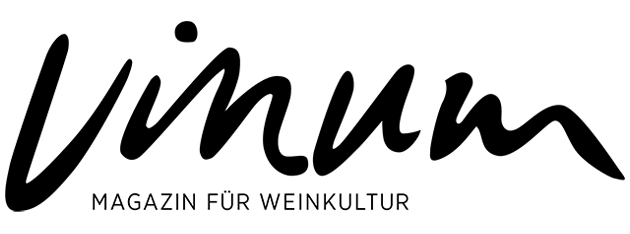Stationen der Weingeschichte
Mengenpolitik

Weniger ist manchmal mehr, aber selten am besten. Denn das Verhältnis von Ertrag und Qualität ist nicht so offensichtlich, wie Weinmacher uns das weismachen wollen.
In den 1920er und 1930er Jahren «erfindet» Frankreich die kontrollierte Ursprungsbezeichnung und schafft damit ein System, das zum Vorbild für die ganze übrige europäische Weinwelt wird. Wer AOC (Appellation d’Origine Controlée) sein will, muss sich an strenge Vorgaben halten.
Festgelegt werden unter anderem die Höchsterträge, und zwar in Hektoliter pro Hektar. Das scheint intelligent und einfach nachvollziehbar. In vielen Herkunftsgebieten liegt die erlaubte Ausbeute bei rund 45 Hektolitern pro Hektar. Wie dieser «Plafond», diese Decke, festgesetzt wird? «Ganz einfach», schmunzelt Vincent de Bez, Mitbesitzer von Château d’Aquéria in Tavel, dessen Vorfahren aktiv an der Gründung der ersten französischen AOC mitgearbeitet haben: «So, dass niemand ihn je erreichen kann. Sonst hätten die Winzer ihn nie akzeptiert.
»In einer Epoche, in der sich der Rebbau eben erst mühsam von Wirtschaftskrise, Reblaus, Kriegen erholt, sind 45 Hektoliter pro Hektar (um bei diesem Beispiel zu bleiben) eine völlig illusorische Grösse für Qualitätsrebbau. Zu allen Zeiten liegen die Höchsterträge (ausgenommen die quasi industriellen Rebanlagen im Languedoc, die nur knapp trinkbaren Basiswein ergeben) bei 5 bis 20 Hektolitern pro Hektar, und «mehr» ist oft Synonym für «besser»: besseres Terroir, bessere Rebarbeit, besseres Mikroklima.
In dem kleinen französischen Dorf, in dem ich lebe, hängen die Erntedeklarationen der letzten Landweinzonen, die hier überlebt haben. Die Hektarerträge liegen alle unter zehn Hektolitern, doch die Weine sind so scheusslich, dass sie sich kaum für Essig eignen. Bloss – wie sehen Rebberge «zu allen Zeiten» aus? Ganz sicher nicht wie moderne Rebanlagen. Zur Zeit der Entstehung der AOCs (und damit der Mengenbeschränkung) stehen Reben zwar bereits in Reih und Glied, doch Klone sind so gut wie unbekannt, der Rebschutz bleibt rudimentär, die Mittel zum Unterhalt sind bescheiden, (Kunst-)Dünger wird kaum verwendet, oft fehlt im Rebberg die Hälfte der Stöcke. Da stösst das Hektoliter-Hektar-System an seine Grenzen: Es sagt nicht, wie viel ein einzelner Stock produziert. Darum haben die AOC-Gründer ihre Rechnung ohne den Wirt gemacht.
Klonforschung (einseitig auf Produktivität ausgelegt), chemischer Pflanzenschutz und modernere Rebanlagen, in denen kein Stock mehr fehlt, sprengen die Erntemengen, und spätestens ab den 80er Jahren werden die Basiserträge mit links übertroffen. Und so kommt es, dass Bordeaux-Weinhändler Christian Moueix vor laufenden TV Kameras mittels goldener Rebschere auf einer Parzelle seines legendären Château Pétrus im Hochsommer Trauben auf den lehmigen Boden fallen lässt, die «grüne Ernte» erfindet und sofort überall tapfer nachgeahmt wird. Möglichst tiefe Erträge gelten für die nächsten 20 Jahre als DAS Werbe- und Preisgestaltungsargument für grosse Weine und solche, die es werden wollen.
Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Und wo diese liegt, hängt von Dutzenden von Faktoren ab, nicht zuletzt vom Klimaverlauf. Es gibt genügend Beweise dafür, dass Typizität und Terroir (was immer das auch heissen mag) bei zu hohen Erträgen auf der Strecke bleiben. Doch bei zu tiefen auch. Der Alkoholgehalt schiesst in die Höhe, es fehlt an Säure – und weg ist die Typizität.
«Warum künstliche Mengenbeschränkung? Um mehr Geld für eine Flasche verlangen zu können? Warum Trauben auf den Boden schmeissen, wenn ich mehr Leute glücklich damit machen kann?», sagt Laurent Vonderheyden von Château Monbrison. Die Betonung liegt auf glücklich.