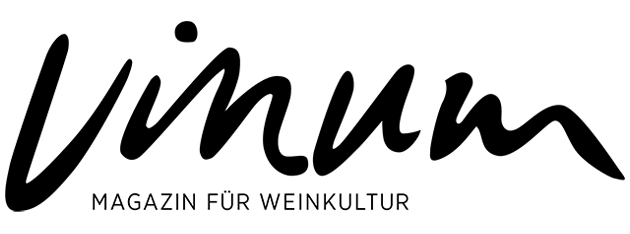Neue Winzer
Burgenlands Weine neu gedacht
Fotos: Helena Lea Manhartsberger, z.V.g.

Man könnte es als stille Revolution bezeichnen, was die jungen Winzer im Burgenland machen. Sie definieren, was Herkunft heute heissen kann, biologisch, radikal ehrlich und handwerklich konsequent. Sie arbeiten mit autochthonen Rebsorten wie Blaufränkisch oder Furmint, lassen sich von Amphoren inspirieren, vertrauen der Natur und verzichten auf Make-up im Keller. Ihre Weine sind leise, aber nicht still. Sie sind Charakterköpfe – so wie ihre Macher.
Das Burgenland ist in Bewegung. Nicht laut, aber mit Nachdruck. Während in vielen Weinregionen Europas Stillstand und Routine dominieren, formiert sich hier eine Generation von Winzern, die mehr als nur Wein produziert. Wenn man Claus Preisingers Weine probiert, spürt man sofort: Hier hat jemand einen klaren inneren Kompass. Der Betrieb in Gols, gegründet im Jahr 2000, war einer der ersten im Burgenland, der biodynamische Prinzipien und konsequente Reduktion zusammenführte, nicht als Dogma, sondern als Haltung. Preisinger denkt Wein nicht als Produkt, sondern als Ausdruck eines Ortes, eines Moments, eines Menschen. Seine rote Cuvée Puszta Libre ist längst Kult in den jungen Weinbars Europas. Ein Rotwein ohne Make-up, ohne Schwefel, mit minimalem Alkohol, aber maximalem Trinkfluss. Saftig, pur, leicht gekühlt, eine Art burgenländischer Beaujolais, aber mit deutlich mehr Erdung.

Sein Kalkstein wiederum, ein reinsortiger Blaufränkisch aus alten Reben auf Kalk und Schiefer, zeigt Preisingers anderes Gesicht: kühle Frucht, kalkige Mineralität, dezente Reduktion, ein Wein mit stiller Tiefe und messerscharfer Präzision. Im Keller arbeitet Presinger mit Fässern und Gefässen aus Ton, Beton, Holz, je nachdem, was der Wein aus seiner Sicht verlangt. Die Trauben werden oft als ganze Trauben vergoren, selbstverständlich spontan und unfiltriert abgefüllt. Kein Eingriff, keine Korrektur. Konsequenterweise stellt Preisinger seine Weine auch nicht mehr zur Qualitätsweinprüfung an. Deshalb darf er auch keine Lagennamen auf die Flaschen schreiben, was ihm und seiner wachsenden Zahl an Fans – vor allem im Ausland – aber herzlich egal ist. Er sagt von sich: «Ich bin kein Regisseur, sondern Beobachter.» Diese Haltung spiegelt sich auch in seinen Etiketten wider, die minimalistisch, grafisch und eigenständig sofort ins Auge fallen. Jeder Wein ist ein Statement und ein leiser Aufruf zum Umdenken. Auch seine weißen Naturweine wie der «KalkundKiesel Weiss» – eine Cuvée aus Weissburgunder, Grüner Veltliner, Welschriesling und Muskateller – oder der expressive Blaufränkisch «ErDELuftGRAsundreBEN» setzen auf Reduktion, Vertrauen und Eigenständigkeit. Sie kommen ohne laute Fruchtaromatik aus, sind fast meditativ im Ausdruck.

Die Balance zwischen innerer Spannung und äusserer Gelassenheit sind Markenzeichen geworden. Claus Preisinger ist keiner, der laut trommelt. Aber seine Weine klingen lange nach. Und sie erzählen davon, wie viel möglich ist, wenn man sich auf das Wesentliche konzentriert: Boden, Rebe, Zeit und die Bereitschaft, auch mal nichts zu tun.

Blaufränkisch und Bodenhaftung
Judith Beck ist eine der eher leisen Stimmen dieses anderen Burgenlands und gerade deshalb eine der wichtigsten. In Gols führt sie den Familienbetrieb seit 2001 in eigener Regie, seit 2007 biodynamisch. Für sie ist Wein kein Produkt, sondern ein lebendiger Organismus – einer, der Zeit und Vertrauen braucht. Becks Weine entstehen mit minimalem Eingriff, spontan vergoren, oft ungeschönt und unfiltriert. Auch ihr Fokus liegt auf heimischen Sorten, allen voran Blaufränkisch und St. Laurent. Besonders eindrucksvoll: der Blaufränkisch Altenberg, ein Lagenwein von kalkreichen Böden mit feiner Würze, kerniger Frische und kühler Eleganz. Kein Fruchtbomber, sondern ein strukturierter, tiefer, fast burgundischer Blaufränkisch mit langem Atem. Auch Weissweine wie der Weissburgunder Bambule! zeigen Becks Stil: zurückgenommen, texturiert, mit griffigem Tannin und salziger Länge. «Bambule!» ist bei ihr das Synonym für Minimalismus – keine Filtration, keine Schönung, keine Temperaturkontrolle. Nur der pure Ausdruck von Rebe, Jahrgang und Boden. Ihre Philosophie ist klar: Der Wein soll nicht gefallen müssen, sondern für sich sprechen. Ehrlich sein. Authentisch. Und manchmal auch kantig. Beck sieht sich nicht als Missionarin, sondern als Beobachterin und Unterstützerin eines natürlichen Prozesses. Ihre Weine sind leise, aber tiefgründig – wie sie selbst.
Ähnlich arbeiten auch Martin Lichtenberger und Adriana González, die auch schon mal als «Die Alchemisten vom Leithaberg» tituliert wurden. Sie führen ihr kleines Weingut in Breitenbrunn am Leithagebirge seit 2008 – mit Fokus auf Herkunft, Finesse und kompromisslose Handarbeit. Der Stil: puristisch, kalkgeprägt, elegant. Ihre Weine sind das Gegenteil von laut. Sie verlangen Aufmerksamkeit, keine Aufmerksamkeitserregung.
Blaufränkisch steht im Mittelpunkt, etwa beim «Muschelkalk rot», der mit feiner Säurestruktur, Kräuterwürze und kühler Frucht glänzt. Kein Muskelprotz, sondern ein tänzelnder Wein mit Tiefe. Im weissen Bereich setzen sie Massstäbe mit Neuburger – einer Sorte, die am Leithaberg auf Muschelkalk und Glimmerschiefer grossartige Ergebnisse liefert. Ihr «Leithaberg weiss» ist das Gegenteil von den üblichen Weinen der Sorte, er ist präzise, schlank, salzig – ein Wein mit vibrierender Energie und feinem, aber langem Nachhall. Im Keller wird mit Schwerkraft gearbeitet, ohne Pumpen. Vergoren wird spontan in grossen Holzfässern, Zement oder Amphoren. Der Ausbau erfolgt auf der Vollhefe, teilweise bis zu zwei Jahre. Eingriffe? Fehlanzeige. «Je weniger wir tun, desto besser», lautet das Credo. Lichtenberger-González sind genau wie Judith Beck vergleichsweise stille Stars der Szene. Ihre Weine sind nicht konstruiert, sondern organisch – klar, mineralisch, präzise. Sie stehen für einen kühlen, fast nordischen Stil, der dem Burgenland ein völlig neues Klangbild verleiht.

Eisenberg neu gedacht
Am südlichsten Zipfel des Burgenlands, am Eisenberg, bewirtschaften Christoph Wachter und seine Schwester Julia rund 15 Hektar in einigen der besten Lagen der Region – Saybritz, Ratschen, Szapary. Seit 2010 führt Christoph Wachter den elterlichen Betrieb, biologisch zertifiziert, mit starkem Fokus auf Lagentypizität und sanfte Vinifikation. Blaufränkisch ist für ihn keine Sorte, sondern ein Medium. Seine Lagenweine zeigen eindrucksvoll, wie stark sich Boden, Exposition und Mikroklima im Glas widerspiegeln. Der Saybritz etwa stammt von eisenhaltigem Grünschieferböden – ein kraftvoller, aber eleganter Blaufränkisch mit kühler Würze, tiefem Tannin und langem Nachhall. Der Ratschen hingegen wirkt luftiger, seidiger, fast tänzelnd. Im Keller setzt er auf Ganztraubenvergärung, lange Maischestandzeiten und Ausbau in gebrauchten Fässern. Alles spontan, alles ohne Schönung. Seine Philosophie: Der Wein soll sich selbst definieren, nicht durch Technik, sondern durch Herkunft. Auch die Weissweine zeigen das neue Selbstbewusstsein der Region: keine üppigen Fruchtweine, sondern Welschriesling mit Anspruch und mit Zukunft. Christoph gehört zu jener Generation, die den Eisenberg aus der Nische geholt hat. Seine Weine sind kraftvoll, aber nie laut – und erzählen vom Potenzial einer Region, die sich neu erfindet, ohne sich selbst zu verlieren.
Purismus am Neusiedler See
In Jois, am östlichen Fuss des Leithagebirges, macht Markus Altenburger genau das, was man gemeinhin «weniger ist mehr» nennt. Kein grosses Aufheben, keine PR-Sprüche, dafür leise Weine mit Tiefgang und Haltung. Seit 2006 führt er den elterlichen Betrieb, mittlerweile biologisch zertifiziert, mit dem klaren Ziel, die Herkunft der Weine zum Sprechen zu bringen. Nicht in Form von Etikettenrhetorik, sondern im Glas. Seine Weinberge liegen auf Kalk und Schiefer und genau das bestimmt den Ton. Vor allem beim Blaufränkisch, der hier nicht nach Kraft, sondern nach Spannung strebt. Der «vom Kalk» etwa ist ein Musterbeispiel: salzig, kühl, mit vibrierender Energie und feiner Würze. Kein Fruchtmonster, sondern ein Wein, der zieht und leise nachhallt.
Altenburger ist kein Ideologe, aber einer, der weiss, was er tut und wann er es besser lässt. Ausbau in gebrauchten Holzfässern, Beton, Zement oder Edelstahl – je nachdem, was der Wein braucht und nicht was der Markt verlangt. «Ich will, dass der Boden im Wein bleibt», sagt er. Auch im Weissweinbereich gehört Altenburger zu den eher Stillen, aber eindeutig Stilprägenden. Sein Chardonnay «vom Kalk» ist fast burgundisch in seiner Kühle und Textur, mit präzisem Biss und langer Linie. Der «Neuburger betont» ist trotz seines ungewöhnlichen Namens ein Orange Wine im besten Sinne: Maischevergoren, ungeschönt und strukturiert – aber nie orange nur um der Farbe willen. Seine Weine sind keine Lautsprecher, sondern Zuhörer. Sie stellen keine Behauptungen auf, sie lassen sich verstehen. Und damit steht er exemplarisch für jene neue burgenländische Winzergeneration, die Herkunft nicht inszeniert, sondern lebt.

In seiner Haltung weiss er sich mit Markus Hammer im geistigen Bunde, der ebenfalls keiner ist, der sich in den Vordergrund drängt. Und doch zählt er zu jenen Winzern, die das Burgenland mit leiser Konsequenz mitprägen. In Rust, am Westufer des Neusiedler Sees, arbeitet er auf rund zehn Hektar nach biodynamischen Prinzipien – mit festen Überzeugungen, aber ohne ideologischen Eifer. Seine Weine sind ebenso klar im Ausdruck wie zurückhaltend im Ton: Sie sprechen von Herkunft, ohne laut zu werden. Blaufränkisch steht bei Hammer im Mittelpunkt, insbesondere in der kraftvollen Reserve «Rusterberg». Der Wein ist tiefdunkel, aber nicht schwer. Er zeigt Kirsche, Kräuter, kalkige Kühle, mit feinmaschigem, mürbem Tannin und salziger Länge. Kein Macho-Wein, sondern ein ruhiger Kraftakt mit Tiefgang. Sein reinsortiger Merlot ist auch eine Art Unikat, er zeigt Charakter statt simplen Charme, ist dunkel, kühl und strukturiert. Kein weichgespültes Kraftpaket, sondern ein Wein mit Spannung und Rückgrat. Ein Beispiel dafür, wie viel Herkunft in einer internationalen Sorte stecken kann – wenn man sie ernst nimmt. Und die Weissweine? Wer etwa beim Sauvignon Blanc tropische Früchte erwartet, wird angenehm enttäuscht. Hier geht es nicht um Aroma-Feuerwerk, sondern um Textur, Frische und leisen Ausdruck. Die Trauben stammen aus den Lagen rund um Rust und werden mit dem Fokus auf Säure und Struktur gelesen. Vergoren wird spontan, der Ausbau erfolgt in neutralem Holz. In Ergebnis zeigt sich der Sauvignon am Gaumen klar, fast steinig, mit kühlem Zug und salzigem Finish. Ein Sauvignon, der nicht gefallen will, sondern Haltung hat. «Ich will keine Handschrift hinterlassen, der Wein soll selbst sprechen», sagt er. Markus Hammer ist ein stiller Reformer. Seine Weine sind kantig, präzise und überraschend lang im Nachhall, wie Gedanken, die erst beim zweiten Schluck ganz ankommen. Und sie zeigen einmal mehr: Das neue Burgenland hat viele Gesichter. Und jedes davon erzählt eine Geschichte, die es wert ist, gehört zu werden.
Eine Region im Aufbruch
Was die neue Winzergeneration des Burgenlandes bei aller Unterschiedlichkeit im Kern verbindet, ist mehr als die gemeinsame Herkunft. Es ist eine Haltung. Eine neue Art, Wein zu denken – nicht als profanes Produkt, sondern als kulturellen Ausdruck. Sie arbeiten biodynamisch oder biologisch, aber ohne ideologische Schablonen. Sie setzen auf autochthone Sorten, ohne sich regional einzuengen. Und sie vertrauen der Natur, ohne ihre Verantwortung aus den Augen zu verlieren. In ihren Kellern herrscht Ruhe, nicht Technik. In ihren Flaschen findet man Herkunft statt Hochglanz. Und in ihrer Kommunikation Ehrlichkeit statt Inszenierung. Das Burgenland, lange Zeit eher im Windschatten prominenterer Regionen, wird durch sie zur Bühne für einige der spannendsten Weine Europas. Still, klar, kompromisslos.
Die neue Generation zeigt, wie kraftvoll es sein kann, wenn man Tradition nicht nachahmt, sondern weiterdenkt. Wenn man auf Tiefe statt auf Tempo setzt. Und wenn man bereit ist, Fehler als Teil des Weges zu akzeptieren. Ihre Weine sind das Resultat dieses Denkens – und zugleich der beste Beweis dafür, dass Herkunft nicht altmodisch sein muss, sondern radikal modern sein kann.