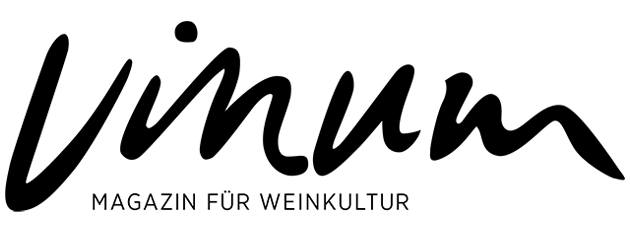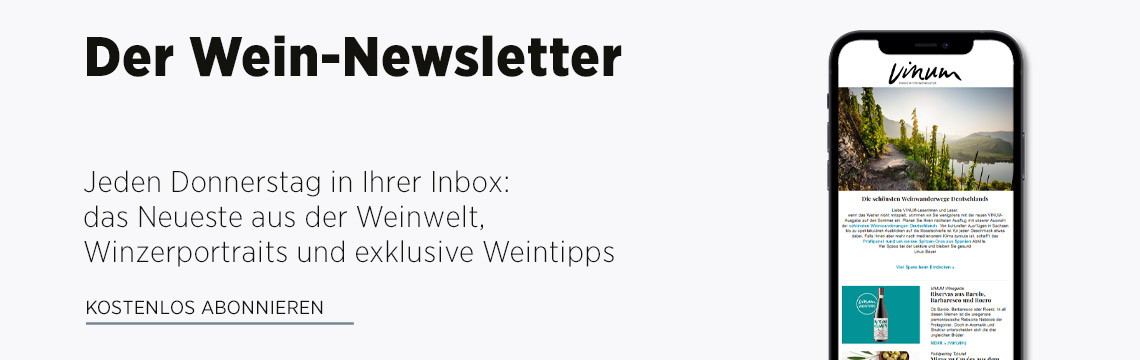Pyramide ohne Pharao
Profipanel: Sekt Austria im Blindtasting
Text: Harald Scholl, Fotos: Angela Kalista

Ein einzigartiges Getränk mit Geschichte und Zukunft: Jahrzehntelang schien der österreichische Sekt im Niemandsland zwischen Massenware und handwerklichem Geheimtipp umherzudümpeln. Seit genau zehn Jahren sorgt ein dreistufiges Herkunftssystem für klare Verhältnisse und neues Selbstbewusstsein unter den rot-weiss-roten Sprudlern. Wir haben uns an die Gläser gemacht, um diesem Erfolg auf den Grund zu gehen.
Sekt hat in Österreich eine weitaus längere Tradition, als man ihm gemeinhin zutraut. Schon 1842 liess sich Robert Alwin Schlumberger, ein aus Stuttgart stammender Kellermeister der Champagne, im niederösterreichischen Bad Vöslau nieder – und gründete dort das erste österreichische Sektunternehmen. Der Vöslauer Goldeck avancierte rasch zum Lieblingsgetränk der k.u.k.-Gesellschaft. Man prostete einander mit Goldrandkelchen zu, in Wien, Budapest und sogar Moskau. Doch während in Frankreich eine bis heute geltende Sekt-, pardon: Champagnerkultur wuchs, verlor sich der österreichische Schaumwein nach dem Ende der Monarchie in einer gewissen Beliebigkeit. In der Nachkriegszeit übernahmen industrielle Kellereien das Kommando, produziert wurde, was sich gut und günstig verkaufen liess. «Österreichischer Sekt war lange ein Produkt ohne Herkunft – und damit auch ohne Haltung», bringt es der heutige Obmann des Österreichischen Sektkomitees, Andreas Krammer, auf den Punkt. Weniger bekannt, aber umso bemerkenswerter ist ein kleines Detail der österreichischen Sektgeschichte: Die Agraffe – jenes unscheinbare Drahtgeflecht, das den Korken auf der Sektflasche hält – geht aller Wahrscheinlichkeit nach auf zwei Österreicher zurück. Adolf und Friedrich Rückert, Mechaniker und Tüftler aus Wien, entwickelten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Vorrichtung, mit der sich der Druck in der Flasche zuverlässig sichern liess. Eine echte Innovation, denn zuvor wurden die Korken meist nur mit Schnüren oder gewachsten Fäden befestigt, was häufig zu unkontrollierten Öffnungen oder gar Explosionen führte. Der Drahtverschluss, wie wir ihn heute kennen, wurde 1860 von den Brüdern patentiert und bald europaweit eingesetzt – auch in der Champagne. Damit haben die Österreicher dem Sekt nicht nur den prickelnden Inhalt, sondern auch ein Stück funktionaler Formensprache mitgegeben.
Der Anfang vom Umdenken
In den 1990er Jahren begannen einige wenige Winzer, den Schaumwein wieder ernst zu nehmen – nicht als Nebenprodukt, sondern als gleichwertige Kategorie neben ihren Lagenweinen. Namen wie Bründlmayer, Malat, Steininger oder Szigeti tauchten erstmals auf Speisekarten ambitionierter Gastronomiebetriebe auf. Doch die Szene war fragmentiert, das Image diffus: Was ist ein österreichischer Sekt? Wofür steht er? Und vor allem: Woher kommt er? 2013 wagte man den Schulterschluss. Unter dem Dach des Österreichischen Weinbauverbands formierte sich das Sektkomitee, ein Gremium aus Vertretern grosser Kellereien, kleiner Winzer, regionaler Verbände und Behörden. Ziel war es, dem Sekt jene Struktur zu geben, die sich bei den stillen Weinen mit dem DAC-System längst bewährt hatte: Herkunft statt Beliebigkeit, Qualität statt Quote. «Das war ein Ringen – kein Sonntagsausflug», so beschreibt Johannes Harkamp, Bio-Winzer aus der Südsteiermark und einer der engagiertesten Sektmacher der jüngeren Generation, den langwierigen Prozess. «Es war klar, dass wir nicht alle über einen Kamm scheren können. Aber es musste endlich eine Linie geben, und die heisst Herkunft.» Einigkeit war trotzdem nicht leicht zu erreichen. Die grossen Häuser fürchteten um ihre Marktanteile, kleinere Weingüter wollten kein System, das ihnen die Experimentierfreude nahm. Am Ende wurde ein Kompromiss gefunden, der sich sehen lassen kann: Das dreistufige System «Sekt Austria» wurde eingeführt – mit Klassik, Reserve und Grosser Reserve als klar definierten Kategorien (siehe Infokasten). Diese «Sekt-Pyramide» ist seit 2015 in Kraft, vollständig umgesetzt seit dem Jahr 2018.
Junge Wilde, alte Meister
Die Dynamik, die das Herkunftssystem ausgelöst hat, ist enorm. Zahlreiche junge Winzer entdecken den Sekt neu – nicht als Randnotiz, sondern als Profilierungsmöglichkeit. Theresa Piriwe aus dem Traisental etwa sagt: «Ich will zeigen, dass Sekt kein Zufallsprodukt ist, sondern eine Haltung.» Ihr Extra Brut aus dem Muskateller zeigt, wie elegant Aromatik und Struktur zusammenspielen können. Gleichzeitig investieren auch Traditionshäuser in Qualität. Schlumberger hat seine Linie überarbeitet, Szigeti experimentiert mit autochthonen Sorten wie Neuburger oder Zierfandler, Bründlmayer baut die Reservepalette kontinuierlich aus. «Diese Kategorie ist erwachsen geworden», meint Willi Bründlmayer. «Wir vergleichen uns heute nicht mehr mit Prosecco, sondern mit der Champagne – auf Augenhöhe.» So erfolgreich das eingeführte System heute auch ist – der Weg dorthin war steinig. «Wir mussten nicht nur die Branche überzeugen, sondern auch die Behörden», sagt Andreas Krammer. Vor allem die Kontrolle der Herkunft, die Klarheit bei Reifedauern und die Definition der Stufen sorgten für lange Abstimmungen mit dem Bundesamt für Weinbau. Und auch die Kommunikation zum Konsumenten ist noch ausbaufähig. Viele kennen den Begriff «Sekt Austria» zwar, wissen aber wenig über die Unterschiede der einzelnen Qualitätsstufen. Trotz all dieser Herausforderungen hat sich eines deutlich gezeigt: Österreichischer Sekt hat in den letzten zehn Jahren eine erstaunliche Wandlung hingelegt. Vom unterschätzten Nebenprodukt hat er sich zum ernst zu nehmenden Aushängeschild gemausert. Von der Marke ohne Gesicht zur Herkunft mit Substanz. Das dreistufige System ist dabei nicht nur ein bürokratischer Rahmen, sondern entpuppt sich als ein kultureller Quantensprung, der von Produzenten wie Konsumenten angenommen wird.
Wachstum mit Profil
Die neue Ernsthaftigkeit zeigt Wirkung – auch am Markt. Während der Konsum internationaler Schaumweine in Österreich seit Jahren relativ stabil bleibt, wächst die Nachfrage nach heimischem Qualitätsschaumwein kontinuierlich. Im Jahr 2023 wurden laut Statistik Austria rund 18 Millionen Flaschen Sekt produziert, davon entfiel bereits ein gutes Viertel auf die geschützten Kategorien des Herkunftssystems «Sekt Austria». Die Tendenz ist steigend. Vor allem die mittlere und obere Preiskategorie legen zu – ein klares Zeichen, dass Konsumenten Qualität zunehmend erkennen und honorieren. Auch im Export zeigt sich Bewegung: Länder wie Deutschland, die Schweiz und zunehmend auch Skandinavien entdecken den österreichischen Sekt als Alternative zu Crémant oder Prosecco. «Wir merken, dass unser Profil als Herkunft immer klarer wird», sagt Monika Caha von Schlumberger. «Wer einmal eine Grosse Reserve verkostet hat, ist oft überrascht, wie viel Tiefe und Finesse da drinsteckt.» Gleichzeitig nutzen immer mehr Winzer das Herkunftssystem auch als Marketinginstrument: Wer «Sekt Austria» aufs Etikett schreiben darf, steht für Herkunft, Handwerk und Niveau – Grundlagen, die international gefragt sind. Ein Nischenprodukt ist der österreichische Sekt damit nicht mehr. Er ist im Begriff, seinen Platz im globalen Schaumweinregal zu behaupten. Johannes Harkamp hat es einmal griffig formuliert: «Früher wurde gefragt: Warum macht ihr überhaupt Sekt? Heute fragen sie: Wo kann ich ihn kaufen?»

«Grosse Überraschung angesichts der enormen Bandbreite der gezeigten Sekte. Von Easy Drinking bis anspruchsvoll wurde alles abgedeckt. Österreich braucht sich auch hier international gesehen nicht zu verstecken. Nicht zuletzt weil auch die klassischen Rebsorten tolle Variationen entstehen lassen. Das ist richtig grosses Schaumwein-Kino!»
Leo Quarda Weinautor, Wien

«Die unglaubliche Bandbreite an unterschiedlichsten Schaumweinen wirbt für die Sektlandschaft Österreichs. Vor allem das durchgängig gekonnte Handwerk fällt positiv auf, die Winzer wissen wirklich genau, was sie tun. Mittlerweile sind ihre Schaumweine international absolut konkurrenzfähig.»
Michael James Vinothek Vinoe, Wien

«Mit nur 25 Sekten lässt sich die gesamte Bandbreite österreichischen Sektes entdecken. Das sind lauter spannende Charaktertypen, jeder ist eine Entdeckung für sich, aber immer von wirklich vitaler Frische durchzogen. Ganz offensichtlich profitiert Österreich auch hier vom Cool Climate seiner Rebflächen.»
Nicole Harreisser VINUM-Redakteurin, Zürich

«Die stilistische Vielfalt und die Qualitäten des österreichischen Sektes sind beeindruckend. Vom fruchtorientierten Basis-Sekt bis hin zum hefedominierten Autolyse-Monster – es war alles dabei. Da ist in den letzten Jahren sehr viel Gutes passiert. Und wird sicher auch weiter passieren.»
Marko Locatin Österreichischer Genuss-Journalist, Wien

«Man hat das gute Gefühl, dass die österreichischen Winzer vor allem Schaumwein produzieren, den sie selber gerne trinken. Dement-sprechend gross ist die stilistische Bandbreite, und ebenso herausragend ist die Qualität. Das ist eigenständig ‹Austria› und nicht mehr an Frankreich orientiert.»
Michael Kaufmann The Lawies Winebar, Wien
Die Jury

Von links nach rechts
Marko Locatin
Österreichischer Genussjournalist, Wien
Favorit: Markus Altenburger
Michael Kaufmann
Szene-Gastronom, Wien
Favorit: Josef Fritz
Nicole Harreisser
Redakteurin VINUM, Zürich
Favorit: Christina Hugl
Leo Quarda
Weinautor, Wien
Favorit: Kattus
Harald Scholl
Chefredakteur VINUM Deutschland, München
Favorit: Schloss Gobelsburg
Michael James
Vinothek Vinoe, Wien
Favorit: Fred Loimer
Anika Satzinger
Teamleitung Märkte International, ÖWM, Wien
Favorit: Jurtschitsch