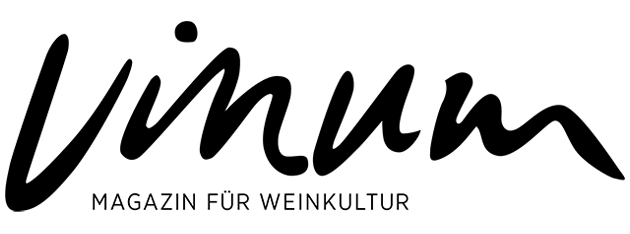Noch nie wurde in der Weinbranche so viel gejammert – noch nie war das Potenzial für Erneuerung so gross. Während die Welt sich dreht, bleibt der Wein gern stehen. Die anderen sollen sich ändern, der Handel, der Verbraucher, die Politik. Nur der Winzer nicht. Der macht wie immer – und wundert sich, dass keiner mehr mitmacht.
Klar, die Lage ist schwierig. Und zwar auf allen Ebenen. Bürokratie, Preisverfall, Absatzkrise, Generation Z, Klimawandel, Gängelung durch Vorschriften, Überproduktion – you name it. Aber die Frage ist doch: Wie lange wollen wir uns noch selbst bemitleiden? Wie lange wollen wir den Abgesang auf die gute alte Weinwelt intonieren, während neue Genussformen – alkoholfrei, fermentiert, divers – längst neue Räume besetzen? Es ist, als stünde die Branche vor einem brennenden Haus und diskutierte, ob sie lieber mit dem alten Kupfereimer oder der modischen Giesskanne löschen will. Währenddessen feiert die Kundschaft längst im Craftbeer-Bistro oder beim Natural Soda ab. Wein? Ist denen zu elitär, zu verbissen, zu vorgestrig. Woran das liegt? Vielleicht daran, dass der Wein sich immer noch für das Mass aller Dinge hält. Nach dem Motto: Was nicht VDP ist, ist nicht ernst zu nehmen. Was nicht Riesling ist, ist nur Ergänzungsrebsorte. Was nicht mindestens 12,5 Volumenprozent hat, ist Kindergeburtstag. Wer keinen Burgunder liebt, hat eh keinen Geschmack. Und überhaupt: Der Markt ist schuld. Die Jugend. Die EU. Die Preise. Aber wehe, einer sagt: Vielleicht liegt es auch an uns. An Winzern. An Händlern. An Weintrinkern.
Man kann die Augen nicht davor verschliessen: Die Welt verändert sich. Menschen trinken anders, sie sind bewusster, konsumieren weniger, kaufen vielfältiger. Sie suchen Geschichten, Charakter, Vertrauen. Aber was macht der Winzer? Er diskutiert, ob ein Kabinett sieben oder acht Promille Alkohol haben darf. Er klagt über die Marktmacht der Discounter – liefert aber genau dorthin. Und er verheddert sich in Herkunftssystemen, die selbst Fachleute nicht mehr erklären können. Dabei gibt es doch Ideen! Gute sogar. Jüngst meldete sich «The Wineparty» zu Wort – ein oft lautes, zumeist launiges, aber ganz sicher nicht dummes Kommunikationsprojekt, das dem Wein nicht weniger als den Friedensnobelpreis verschaffen will. Klingt absurd? Ist es auch. Und gleichzeitig ist es genau richtig. Denn die Aktion bringt auf den Punkt, was speziell dem deutschsprachigen Wein fehlt: ein gesunder Grössenwahn. Die Lust, gross zu denken. Die Fähigkeit, über den eigenen Korkenrand hinauszublicken. Während man sich in der Branche über zu geringe Flaschenpreise beklagt, schlägt «The Wineparty» vor, den Wein als Friedensstifter zu feiern. Und ja, der arme Olaf Scholz mit einem Glas Weissburgunder ist in diesem Kontext ebenso charmant wie verstörend.
Jetzt aber mal los!
Wer das nur für billiges PR-Getöse hält, hat das Prinzip nicht verstanden. Es geht nicht um Oslo – es geht um Aufmerksamkeit. Es geht darum, den Wein wieder als kulturelles, soziales, verbindendes Medium zu begreifen und nicht als agrarische Tragödie mit Alkoholwert. Die Welt braucht weniger Lamentierer und mehr Erzähler. Weniger Jammerposts, mehr Visionen. Kurz: weniger Selbstmitleid, mehr Selbstbewusstsein. Denn es gibt sie ja: die Winzer, die neue Wege gehen. Die mit Leichtigkeit, Ehrlichkeit und Substanz begeistern. Die sich nicht als Opfer der Umstände sehen, sondern als Gestalter. Die mehr wollen als Bewertungen, Nominierungen und Likes. Sondern Menschen erreichen. Mit Haltung, mit Produkten – und ja: auch mit Emotion.
Der Wein kann das. Immer noch. Aber er muss es wollen. Und er muss aufhören, sich ständig selbst kleinzureden. Niemand kauft gern von jemandem, der unentwegt davon erzählt, wie schlecht es ihm eigentlich geht. Wer keine Freude mehr am eigenen Produkt hat, sollte überlegen, ob er nicht lieber Förster wird. Da arbeitet man auch an der frischen Luft und muss sich wahrscheinlich weniger bücken. Und überhaupt: Wer sagt eigentlich, dass Veränderung immer Verzicht bedeutet? Vielleicht geht es letztlich überhaupt nicht darum, dem alten Weinbild nachzutrauern, sondern vielmehr darum, ein neues zu zeichnen. Eines, das Lust macht. Das neugierig macht. Das verbindet statt belehrt. Warum nicht ein Weinlokal ohne Flaschen, nur glasweise? Warum nicht ein YouTube-Format mit echtem Witz? Warum nicht ein Preis für die lustigste Weinkarte? Warum nicht einfach mal anders denken? Also: weniger Lamento, mehr Leidenschaft. Weniger Rückspiegel, mehr Fernlicht. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Party. Denn wenn wir den Wein nicht feiern – wer dann?
Sprechen auch Sie Klartext!
Sie haben kein Facebook, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion@vinum.ch.