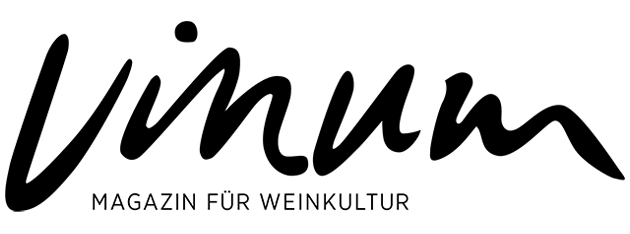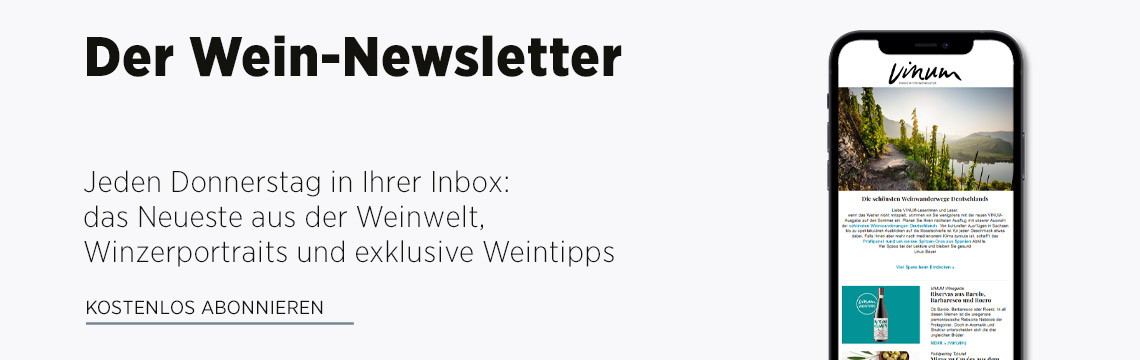Wenn sich im Bioanbau nicht schnell etwas ändert, dürfte diese Anbauweise keine grosse Zukunft mehr haben
Bioanbau – war’s das?
Text: Harald Scholl; Fotos: z.V.g., GettyImages / Juergen Bauer Pictures, Roland Lenz

Das Weinbaujahr 2021 war für viele Winzerinnen und Winzer eine Katastrophe, der Befall mit Falschem Mehltau (Peronospora) hat vor allem die biologisch zertifizierten Betriebe hart getroffen. Es gibt nicht wenige Weingüter, die ganz konkret um die Existenz kämpfen, Ernteeinbussen bis zu hundert Prozent sind keine Seltenheit, 50 Prozent sind es im Durchschnitt. Wenn sich im Bioanbau nicht schnell etwas ändert, dürfte diese Anbauweise keine grosse Zukunft mehr haben.
Eine solch dezidierte und klare Aussage eines Winzers bekommt man als Journalist auch nicht alle Tage: «Die grösste unternehmerische Fehlentscheidung meiner Berufskarriere war die Umstellung auf Bioanbau», sagte im Spätsommer ein Winzer am Telefon, angesprochen auf das Thema Ernte 2021. Ein paar Basisweine würde er aus diesem Jahr wohl auf die Flasche bringen, aber weder Orts- noch Lagenweine hätten den massiven Befall mit Falschem Mehltau überstanden. Und das obwohl er schier unglaubliche 25-mal für den Pflanzenschutz mit seinem Traktor in die Weinberge gefahren war; üblich sind in einem durchschnittlichen Jahr etwa fünf bis zehn Fahrten. Aber anders war dem Befall mit dem Falschen Mehltau nicht beizukommen, andauernder Regen in Verbindung mit warmen Temperaturen sorgte für ein dampfig-feuchtes Klima, dass für Pflanzenschädlinge wie Peronospora wie geschaffen ist.

Dieser verstärkte Maschineneinsatz ist vom Gedanken der Ökologie natürlich weit entfernt, denn die negativen Folgen für den Boden in den Weinbergen und die Umwelt sind nicht von Pappe. Vermehrte Fahrten heisst mehr Kraftstoff, heisst mehr Kupfer – das einzige zugelassene Mittel zum Pflanzenschutz im Bioanbau –, und es heisst Bodenverdichtung durch die schweren Maschinen. Das ist besonders schlecht, wenn die Böden auch noch feucht sind, denn dadurch wird die Verdichtung noch verstärkt. Vom persönlichen Risiko durch rutschige Hänge ist da noch gar keine Rede. Kurzum: Ein Sommer wie der 2021 ist für Biowinzer eine Katastrophe.
Kupfer gegen Falschen Mehltau?!
Im ökologischen Weinbau haben die Winzer zur Bekämpfung des Falschen Mehltaus in erster Linie kupferhaltige Pflanzenschutzmittel zur Verfügung. In regulären Jahren wird Kupfer mit verschiedenen anderen Mitteln regelmässig im Abstand von etwa zehn Tagen in den Weinbergen versprüht. Das Schwermetall Kupfer ist eines der ältesten bekannten Pilzbekämpfungsmittel und wird traditionell in der gesamten ökologischen Landwirtschaft eingesetzt. In Deutschland liegt der Grenzwert der maximal zulässigen Reinkupfermenge derzeit bei drei Kilogramm pro Hektar und Jahr, aufgrund der besonderen Umstände im Sommer 2021 wurde der Wert auf fünf Kilogramm angehoben. Das war vielen Winzern auch nicht wirklich recht, denn Kupfer reichert sich im Boden an, in der Wissenschaft spricht man von «Ökotoxikologie durch Kupfer». Strategien zur Reduzierung des Kupfereinsatzes werden schon seit über zehn Jahren gefordert, passiert ist aber noch nichts.
«Bis zu unglaubliche 25 Mal musste 2021 für den Pflanzenschutz mit dem Traktor in die Weinberge gefahren werden.»
Denn Alternativen zum Kupfer gibt es im Moment nicht wirklich. Zwar werden dazu Gesteinsmehle immer wieder eingesetzt, aber eine echte und vor allem wirksame Alternative ist beim gegenwärtigen Stand der Forschung nur die Phosphonsäure. Bis 2014 wurde dieses Mittel von den Zulassungsbehörden als sogenanntes Pflanzenstärkungsmittel gelistet und als solches auch in der biologischen Landwirtschaft eingesetzt. Aber nicht zuletzt aufgrund des Drucks durch die europäischen Nachbarländer Italien und Frankreich wurde Phosphonsäure vom Pflanzenstärkungsmittel zu einem Pflanzenschutzmittel umdeklariert – und stand damit den Biowinzern nicht mehr zur Verfügung. Kleiner Hinweis am Rande: In den genannten Weinbaunationen war Falscher Mehltau nie ein grosses Thema, deshalb fiel es den dortigen Lobbyisten relativ leicht, sich gegen die Phosphonsäure stark zu machen und den dortigen Biowinzern einen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Seit dem Sommer 2021 ist aber auch in Italien und Frankreich Falscher Mehltau ein Thema, viele Biowinzer wären froh, wenn sie das Mittel zur Verfügung hätten. Wie sagt doch Schillers Wallenstein so treffend: «Das eben ist der Fluch der bösen Tat, dass sie, fortzeugend, immer Böses muss gebären.»
Schadenfreude ist aber nicht wirklich angebracht: Auch wenn man sich auf europäischer Ebene einigen würde, aus der Phosphonsäure wieder ein Pflanzenstärkungsmittel zu machen, für die deutschen Biowinzer wäre damit trotzdem nicht alles in Butter. Denn jetzt kommen die deutschen Bioverbände ins Spiel, die ihrerseits ganz unterschiedliche Haltungen dazu haben. Die einen würden es zulassen, die anderen nicht. So oder so: Die wirklich Leidtragenden sind in fast jedem Fall die Winzer. Die Diskussionen und Genehmigungsverfahren werden Jahre brauchen, zu viele Jahre. Denn ein solches Peronospora-Jahr wie 2021 dürfte für viele Betriebe Grund genug sein, den Bioanbau an den Nagel zu hängen.
Ohne politischen Druck wird es nicht gehen
Im Gespräch mit Richard Östreicher

Richard Östreicher
ist gelernter Winzer aus Sommerach in Franken. Er hat sich auf Rot- und Weissweine im burgundischen Stil spezialisiert, seine Weine sind in der gehobenen Gastronomie und bei ambitionierten Weintrinkern gesucht. 2018 wurde der Betrieb auf biologische Bewirtschaftung umgestellt, der Jahrgang 2021 ist der erste, bei dem das auch auf den Weinflaschen vermerkt werden durfte.
Östreicher ist Mitglied beim Bioverband Naturland. Hier schätzt er die persönliche Beratung, vor allem Neueinsteiger in das Thema werden nach seiner Einschätzung gut betreut. Bioanbau ist für Östreicher eine Notwendigkeit. Er vergärt seine Weine alle spontan, also mit natürlichen Hefen. Und «scharfe» Mittel im Weinberg sind schlecht für die natürlichen Hefen, die sensibler als Reinzuchthefen sind.
Richard Östreicher, mit ein wenig Abstand lässt sich das Weinjahr 2021 vielleicht etwas gelassener kommentieren, trotz der Widrigkeiten. Wie ist es denn bei Ihnen gelaufen?
Soll ich es kurz machen? Katastrophal! Weil Wärme und Feuchtigkeit fast schon subtropisch waren, stellte ich mir während des Sommers mehr als einmal die Frage: «Soll man Reis pflanzen, bin ich auf dem falschen Kontinent?» Mindestens einmal pro Woche habe ich im Kopf die Biozertifizierung zerrissen. Ich bin alle vier bis fünf Tage in die Reben rausgefahren, und jedes Mal sah es im Weinberg schlimmer aus. Es war wirklich deprimierend.
Es war vor allem der Falsche Mehltau – Peronospora –, der die Rebstöcke befallen hat, richtig?
Pero ist normalerweise nicht so schlimm, wenn dieser Pilz im Frühjahr auftaucht, ist er eigentlich gut zu behandeln, etwa zwei bis drei Wochen nach der Blüte trocknet der Pilz aus, weil ihm die lebenswichtige Feuchtigkeit fehlt. Normalerweise. In diesem Jahr hat er sich aber pudelwohl gefühlt, es war warm und feucht, also ideales Pilzwetter. Und der Regen hat zusätzlich den Pilz von den Blättern gewaschen und somit auch noch überall verteilt. Der Pero trocknet die Beeren aus, sie sehen aus wie rosiniert. Bei mir hat es vor allem den Merlot getroffen, da habe ich rund 70 Prozent Ausfall. Immerhin: Die französischen Klone vom Chardonnay und Pinot Noir sind halbwegs gut durchgekommen, aber deutliche Einbussen gibt es auch da. Das ist deshalb besonders schmerzhaft, weil der Frost im Jahr 2020 auch schon erheblichen Schaden angerichtet hatte. Zwei solche Jahre aufeinanderfolgend sind wirtschaftlich kaum zu schaffen.
Wie sah denn die Arbeit im Sommer 2021 ganz konkret aus?
In einem normalen Jahr muss ich maximal zehnmal in die Weinberge fahren, in diesem Sommer waren es 16 Fahrten. Mal abgesehen davon, dass sich die Ernte trotzdem nicht komplett retten liess und ich etwa 40 Prozent weniger geerntet habe, sind die Kosten auch deutlich höher. Mehr Diesel, mehr Spritzmittel, mehr Zeit – weniger Ertrag. Das rechnet sich natürlich nicht wirklich. Zumal auch noch die Erntekosten deutlich höher waren. Wir haben in diesem Jahr für jede Rebzeile acht Stunden gebraucht, jede Traube musste einzeln untersucht werden, die faulen Beeren mussten rausgeschnitten werden, das ist arbeits- und damit zeitaufwändig. Ich habe 2021 Durchschnittserträge von 20 bis 25 Hektoliter, da fragt man sich schon: «Was für einen Blödsinn mache ich da eigentlich?» Das kann man sich in einem Jahr erlauben, aber bei zwei Jahren hintereinander wird es schon eng. Wenn 2022 nicht ein Superjahrgang wird, dürfte es tatsächlich existenzbedrohend für etliche Betriebe werden. Wenn bei den aktuellen Rahmenbedingungen für den Bioanbau der eine oder andere Winzer abspringt und sich vom Bioanbau verabschiedet, würde mich das nicht wundern. Denn das lässt sich alles betriebswirtschaftlich gar nicht mehr schönrechnen, geschweige denn lassen sich die Mehrkosten auf die Preise aufschlagen. Da spielt der Kunde verständlicherweise nicht mit.
Was muss denn geschehen, um Bioanbau für die Betriebe wirtschaftlich zu halten?
Kurz gesagt: Bio braucht mehr Unterstützung von politischer Seite, sonst wird das nichts. Die Konsumenten sind zwar offener als früher und das Thema Preis ist bei weitem nicht mehr so sensibel. Immer mehr Menschen sind bereit, auch etwas höhere Preise für gute Bioweine zu bezahlen. Dennoch lassen sich die Verluste nicht wirklich in Preise umsetzen. Wir brauchen einfach andere Möglichkeiten, auf Umweltereignisse wie 2020 mit dem Frost oder wie jetzt im Jahr 2021 mit dem Falschen Mehltau reagieren zu können. Es wurde zwar kurzfristig die Grenze für den Einsatz von Kupfer von drei auf fünf Kilogramm pro Hektar hochgesetzt, aber das ist für mich keine wirkliche Alternative. Schwermetall – und nichts anderes ist Kupfer – im Weinberg finde ich nicht wirklich gut. Eine Chance wäre der Einsatz der phosphonathaltigen Pflanzenstärkungsmittel, das hätte in diesem Jahr sicher vieles verhindert. Aber da muss auf europäischer Ebene noch einiges bewegt werden. Ich jedenfalls lege nicht dafür die Hand ins Feuer, das im nächsten Jahr nochmal mitzumachen. Wenn es mehr solche Jahre wie 2021 gibt, wird es eine grosse Flucht aus dem Bioanbau geben. Und nicht nur das: Mein Nachbar hier in Sommerach hat auch schon mit Bioanbau geliebäugelt, er arbeitet jetzt schon sehr schonend und ähnlich wie ich. Aber als er gesehen hat, was in diesem Sommer los war, ist er ins Grübeln gekommen. Er hat als konventioneller Winzer kaum Verluste, ich als Biowinzer 40 Prozent. Welchen Schluss er daraus zieht, kann sich wohl jeder selbst denken.
Herausforderungen im Bioweinbau
Im Gespräch mit Petra Neuber

Petra Neuber
ist seit Anfang 2021 Geschäftsführerin von Ecovin. Davor verantwortete die Marketingfachfrau seit April 2020 die Bereiche Veranstaltungsmanagement und Kommunikation für Ecovin.
Sie ist gelernte Winzerin und hat an der Hochschule Geisenheim University Internationale Weinwirtschaft studiert. Zudem absolvierte sie das Traineeprogramm «Ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft» des Bundes. Zu ihren beruflichen Stationen gehörten die Mack & Schühle AG, einer der grössten Weinhändler Europas, das Onlineportal jameda und die Bergsträsser Winzer e.G. Ihre Berufung ist auch ein Signal an die Ecovin-Mitglieder und die Weinbranche insgesamt. Mit ihr soll die Marke Ecovin weiter gestärkt und die Position als erste Adresse für deutschen Biowein gefestigt werden.
Petra Neuber, das Erntejahr 2021 war für deutsche Biowinzer alles andere als einfach. Wie geht es Ihren Mitgliedern?
Je nach Anbaugebiet, Lage und Rebsorte extrem unterschiedlich. Einige Weingüter in Baden haben praktisch ihre komplette Ernte verloren. Andere Ecovin-Betriebe haben dagegen gute Mengen und sehr gute Qualitäten eingefahren. Die meisten bewegen sich dazwischen.
Vor allem der Falsche Mehltau, Peronospora, war ein Grund für die Probleme. Wenn Sie auf die Wirtschaftlichkeit der Betriebe blicken, wird es in Zukunft ohne wirksamere Pflanzenschutzmittel gehen?
Das kommt neben der Klimaentwicklung auch auf die Verbraucher an. Für klassische Rebsorten könnte es eng werden, wenn sich die Wetterextreme häufen. Neuere pilzwiderstandsfähige Rebsorten (Piwi) kommen mit deutlich weniger, aber auch nicht ohne jeden Pflanzenschutz aus. Diese könnten die Zukunft sein, sofern Weintrinker sie goutieren.
Wie steht Ecovin zum Thema phosphonathaltige Pflanzenstärkungsmittel? Unterstützen Sie den Ruf nach Rücknahme der Einstufung als Pflanzenschutzmittel?
Wir setzen uns seit 2012 in Brüssel ununterbrochen für die Zulassung von Kaliumphosphonat im Bioweinbau ein, erst im Dezember hatten wir dazu wieder ein Gespräch mit der EU-Kommission. Vor der Blüte angewendet, wirkt das Mittel rückstandsfrei gegen Pilzkrankheiten. Studien belegen seine Unbedenklichkeit. Es ist uns unverständlich, warum uns die Politik, gerade auf europäischer Ebene, diese Kupferalternative vorenthält.
Der Einsatz von Kupfer für den Pflanzenschutz ist nicht ganz unumstritten. Vor allem weil er in Jahren wie 2021 eine deutlich höhere Fahrtätigkeit fordert; einige Winzer sind 20-mal oder häufiger in die Weinberge gefahren. Und das ist im Hinblick auf die Ökologie nicht wirklich vernünftig. Was kann man tun?
Die 20 und mehr Traktorfahrten waren sicher ein Extrem, bei unseren Mitgliedern lag die Zahl im Schnitt bei 14. Trotzdem war das zu viel. Die Piwi-Rebsorten kamen dagegen mit vier bis sechs Behandlungen aus. Klar ist, dass wir Kupferalternativen brauchen, wenn wir die Klimabilanz verbessern wollen. Aber wir sollten hier Klimaschutz nicht gegen Naturschutz und Gesundheit ausspielen, sondern eine wahrlich nachhaltige Lösung finden.
Die Auswirkungen des Klimawandels machen auch den Biowinzern erheblich zu schaffen, in einem Jahr ist es Spätfrost, im nächsten Peronospora. Und Hagel oder Trockenheit sind auch regelmässig zu beobachten. Wie stellen sich Ihre Mitglieder auf diese Wetterextreme ein? Kann man sich überhaupt darauf einstellen?
Bedingt. Die Anpflanzung der bereits erwähnten Piwis ist gleichzeitig Klimaanpassung – viele dieser Rebsorten vertragen Trockenstress – und aktiver Klimaschutz, da durch weniger Traktorfahrten auch weniger Kohlendioxid ausgestossen wird. Durch ein breites Sortenspektrum in unterschiedlichen Lagen lässt sich das Anbaurisiko streuen.
Welche Hoffnungen oder Forderungen stellen Sie an die Politik? Was muss geschehen, um die wirtschaftliche Existenz der Bioweinbaubetriebe auf Dauer zu sichern?
Unsere erste Forderung heisst ganz klar: mehr öffentlich finanzierte Forschung für den Ökoweinbau, insbesondere den Pflanzenschutz. In der Vergangenheit entfielen ganze zwei Prozent des Agrarforschungsetats auf die gesamte Biobranche. Die anderen Veränderungen, die wir uns wünschen, müssen aus der Gesellschaft kommen, die Politik kann hier nur flankieren. Wir träumen von einem Bewusstsein, einem Verständnis dafür, wie sehr die landwirtschaftliche Erzeugung insgesamt von der Natur abhängt. Die Risiken tragen heute in der Regel die Erzeuger allein, wir müssten hin zu einer solidarischeren Wirtschaftsweise.
Müssen sich vielleicht auch die Bioverbände bewegen und ihre Regeln verändern oder, besser gesagt, anpassen?
Die Richtlinien der Bioverbände entwickeln sich sowieso kontinuierlich weiter, bei Ecovin stehen wir aktuell bei der 15. Fassung seit der Verbandsgründung 1985. Damit reagieren wir auf neue ökologische und gesellschaftliche Anforderungen. Eines ist klar: Der rechtliche Schutz von «bio» oder «öko» ist ein hohes Gut, das wir nicht leichtfertig verspielen. Politik, Verbände und Gesellschaft legen gemeinsam fest, was als Bioprodukt und was als ökologische Wirtschaftsweise gilt. Als Verband sind wir schon immer als Impulsgeber der Biowein-Gesetzgebung vorangegangen. Gleichzeitig werden wir keinen neuen Bio-Regeln aufstellen, denen Wissenschaft, Politik oder Öffentlichkeit widersprechen.
Scholls Meinung:
Bewegt euch!

Er sei die schönste Nebensache der Welt, heisst es vom Wein immer wieder. Dabei hängen allein in Deutschland rund 11 000 landwirtschaftliche Betriebe und viele Existenzen im Handel am Wein, eine Nebensache ist das also sicher nicht. Vor allem nicht, wenn man den landschaftspflegerischen Aspekt berücksichtigt. Die Weinterrassen im Moseltal, die Weinlandschaft im Rheingau, die in den Fels gesprengten Weinberge an der Nahe – das sind von Menschenhand gestaltete Kulturlandschaften, die es so naturnah wie möglich zu erhalten gilt. Nicht nur Weinfreunde, auch Touristen aus aller Welt erfreuen sich an diesen einmaligen Landschaften. Sie sind Teil unserer nationalen Identität, ganz gleich ob man nun Wein trinkt oder nicht. Um dieses Erbe so gut wie möglich zu erhalten, ist der sorgfältige und behutsame Umgang damit unumgänglich; dazu gehört vor allem auch der naturnahe Anbau. Ob das nun biologisch oder biodynamisch geschieht, ist nebensächlich, wichtig ist aber, dass die Menschen, die diese Arbeit leisten, auch davon leben können. Denn sonst wird es weder den Anbau noch die Landschaften weiterhin geben. Aber die Biobetriebe haben keine wirkliche Lobby, noch nicht einmal in ihren Bioverbänden. So ist nicht einmal ein Prozent der bei Bioland organisierten Mitglieder Winzer oder Safterzeuger, von den 4000 Naturland-Mitgliedern sind gerade mal 29 (!) Weinbaubetriebe. Und auch in den anderen Bioverbänden sind diese Quoten relativ ähnlich. Es ist also kein Wunder, dass die Belange der Winzer da nicht oberste Priorität haben. Hinzu kommt auch, dass Weinbaubetriebe ganz andere Rahmenbedingungen haben. Weinbau ist im Wesentlichen eine Permakultur, die Rebstöcke stehen Jahrzehnte in den Weinbergen und werden sorgfältig gepflegt; Weizen, Kartoffeln oder Mohrrüben werden jedes Jahr neu gepflanzt und komplett geerntet. Dass man Ackerwirtschaft und Weinbau nur schwerlich miteinander vergleichen kann, dürfte also klar sein. Umso wichtiger ist es daher, dass die deutsche Politik die speziellen Interessen und Bedürfnisse der biologisch arbeitenden Weinbaubetriebe ernst nimmt und diese auch auf europäischer Bühne vertritt. Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es nicht nur den bestehenden Biobetrieben erlauben zu überleben, gleichzeitig muss die Umstellung auf biologische Wirtschaftsweise wieder attraktiver werden, vor allem wirtschaftlich. Das klingt wie eine weitere Forderung an die Politik, wie sie durchaus üblich und populär ist. Was sie aber keinesfalls weniger wichtig macht. Denn ohne Unterstützung wird es angesichts des Klimawandels auf Dauer keinen nennenswerten biologischen Weinbau in Mitteleuropa geben können. Höchste Zeit also, dass sich was bewegt. Denn die Natur wartet nicht.