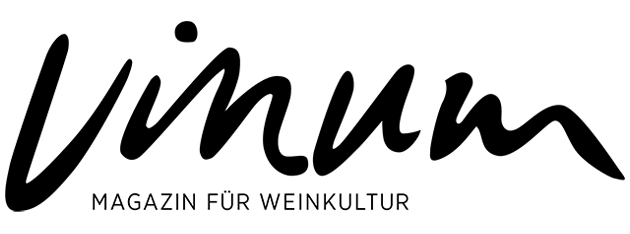Andrea Lauber, Weingut Plandaditsch (Malans)
GRUNDEHRLICH
Text: Benjamin Herzog

Das hatte niemand erwartet: Der beste Pinot Noir dieser Graubünden-Verkostung stammt aus dem Keller von Andrea Lauber, Weissweinspezialist und Obstbauer. Wer glaubt, dass hier nur Glück im Spiel war, täuscht sich gewaltig. Lauber hat auch den besten Pinot Blanc angestellt.
Zehn bis 15 Prozent des Pinot Noir Barrique von Andrea Lauber reifen in amerikanischem Holz. «Das bringt eine gewisse Feinheit und Trinkigkeit», sagt Lauber. Er und sein Kellermeister Hans-Jürg Fopp experimentieren gern mit verschiedenen Hölzern. Beim von uns verkosteten 2007er benutzten sie auch Barriques des österreichischen Fassbauers Franz Stockinger. «Die riechen mir aber zu einseitig, irgendwie nach Karotte», urteilt Lauber, der neben Reb- auch Obstbau betreibt. Auf dem Betrieb werden je 50 Prozent Weiss und Rotwein produziert – untypisch viel Weisswein für die Bündner Herrschaft.
Die ersten Pinot-Blanc-Reben pflanzte Laubers Grossvater 1956, als in der Region noch niemand danach schrie. Bereits 1931 hatte er die Apfelsorte Golden Delicious aus den USA in die Schweiz gebracht. Familie Lauber ist innovativ. Für seine neu gepflanzten Completer-Anlagen wählte Andrea Lauber eine Rebenselektion, die etwas säureärmer als der Durchschnitt ist. Und trotzdem sieht er sich nicht als innovativer Weintüftler. Im Innersten ist Lauber Traditionalist. Seinen Weissweinen gönnt er einen biologischen Säureabbau, und selbst seinen noch jungen Completer-Reben steht er skeptisch gegenüber: War die moderne Züchtung die richtige Wahl? Seine Erfahrungen als Obstbauer verunsichern ihn. «Meine Frau mag die Äpfel unserer neu gepflanzten Jonagold-Bäume nicht», sagt er. Die neuen Züchtungen seien weniger schmackhaft, dafür einfacher anzubauen. «Das Original bleibt degustativ wohl immer das Beste, die Natur weiss, was sie tut.»
Laubers Pinot Noir Barrique 2007 wurde vom VINUM-Profipanel mit 18.5 Punkten bewertet und als besonders elegant, ausgeglichen und von burgundischer Tiefe beschrieben, sein Pinot Blanc 2012 erzielte 17.5 Punkte. Und das waren wirklich keine Zufallserfolge? «Ich überlege schon immer, was ich noch verbessern kann», sagt er, auf seine Vorbilder im Weinmachen angesprochen, und fügt an, dass er momentan plane, die Pinot-Stöcke enger zu pflanzen. Ob Andrea Lauber dazu von Kollegen aus dem Burgund oder aus der Bündner Herrschaft inspiriert wurde? Egal. «Wir sind schon einen Schritt weiter als die Franzosen», sagt er verschmitzt. «Unsere Weine sind jung gut, können aber auch reifen.» Das erklärt vielleicht auch, warum seine Weine der Jury besser gefallen haben als die Gewächse der Bündner Winzer, die das Burgund als grosses Vorbild sehen. Lauber ist bodenständig, ein geradliniger Typ und vor allem: Er rennt keinem Weinstil oder Vorbild hinterher. Er ist er selbst, und das ist auch gut so.
Completer-Kellerei Adolf Boner, Malans
POLARISIEREND
Text: Benjamin Herzog

Giani Boner ist der letzte Winzer in der Bündner Herrschaft, der die heimische Sorte Completer traditionell oxidativ ausbaut. Das Resultat ist ein nussig-sherryartiger Weisswein, der beim VINUM-Profipanel Begeisterungsstürme ausgelöst hat.
Autochthone Rebsorten erleben eine Renaissance, so auch der im Bündnerland heimische Completer. Es gibt ihn heute frisch-spritzig, restsüss oder auch als Schaumwein. Früher wurden die Completer-Weine jahrelang gelagert, um ihre Säure erträglich zu machen. Solche Weine schmecken unfruchtig-nussig, sind stark von ihrem Ausbau geprägt und damit oxidativ. Heute ist nur ein einziger Winzer geblieben, der den alten, sherryartigen Stil konsequent verfolgt: Giani Boner von der Completer-Kellerei in Malans. Aktuell verkauft Boner den 2001er, zur VINUM-Verkostung eingereicht hat er den 2000er. Kein anderer Completer in dieser Verkostung erhielt die hohe Bewertung von 18 Punkten. «Die meisten Kunden haben den 2000er noch im Keller liegen», sagt Boner gelassen. «Completer braucht Zeit.» Das kann man so unterschreiben.
Boners Completer gärt im Herbst langsam durch, im Winter stehen die grossen Holztüren zum Keller dann offen, damit der Wein erst im folgenden Frühling in den biologischen Säureabbau geht. Danach folgt eine Lagerung in der Barrique – bis zu acht Jahre lang. Schon Boners Grossvater ist mit dem Completer so verfahren. Dass diese Methoden modernem Winemaking förmlich widersprechen, ist Giani Boner egal. Als er während seiner Ausbildung Ende der 90er Jahre in Wädenswil von seinem Vorgehen erzählte, wurde er kurzerhand für verrückt erklärt. «Die machten sprichwörtlich den Handstand, als ich ihnen erzählte, dass der Säureabbau bei mir erst im Frühling erfolgt und dass der Wein im Herbst ganz sicher keinen Schwefel zu sehen bekommt.» Schwefel ist für Boner nicht mehr als eine Versicherung, erst nach der Filtration, kurz vor der Füllung, kommt der Wein damit in Berührung.
Dieses Jahr füllt Giani Boner den Completer aus dem Hitzejahr 2003 ab, elf Jahre nach dessen Ernte. Am besten schmecken ihm zurzeit die Exemplare aus den 80er Jahren. Boner erreicht mit dieser Spezialität natürlich nur einen kleinen Teil der Weintrinker. «Von zehn Kunden suchen vielleicht zwei oder drei danach.» Doch die Gelassenheit, welche die Completer-Produktion erfordert, scheint Giani Boner verinnerlicht zu haben: Von seinem Rotwein Grand Cru ist zurzeit der 2009er im Verkauf, von seinem einfacheren Pinot Noir verlassen gerade die letzten 2010er den Keller. «In unserem Lager in Landquart liegen eigentlich zwei komplette Jahrgänge», erzählt der Winzer. «Für den Treuhänder ist das natürlich ein Horror, für den Weingeniesser aber ein klares Plus.»
Zu Tisch bei Gantenbeins
DER WEG ZU ZWEIT IST HALB SO WEIT
Text: Thomas Vaterlaus

Nicht ganz unerwartet erzielten Martha und Daniel Gantenbein mit ihrem Chardonnay 2010 und dem Pinot Noir 2007 das beste Gesamtergebnis dieses VINUM-Profipanels. In ihrer modernen Küche im alten Fläsch gaben sie uns Einblick in ihre individuelle Welt des guten Geschmacks.
«Martha, du bisch doch dä Schef de Service!» oder manchmal auch ein etwas resoluteres «Material fasse!» schallt bis spät nach Mitternacht von der chromstahlglänzenden Semi-Gastro-Küche ins Esszimmer gleich nebenan, in diesen so unscheinbaren, aber so wichtigen Raum, der sich in all den Jahren des gantenbeinschen Aufstiegs kaum verändert hat: rundum warmes Holz, ein weisser Kachelofen, der Holztisch mit den sechs Stühlen, ein restauriertes, knallrot bezogenes kleines Sofa, das an eine Ottomane erinnert und meist von Matteo, dem 18-jährigen Gantenbein-Kater, beansprucht wird, und natürlich die Kommode mit den vielen Weinkaraffen darauf. In diesen vier Wänden hat sie also stattgefunden, die nun schon fast 30 Jahre währende Suche nach dem Besten im Glas und auf dem Teller. Degustierend, trinkend, essend, diskutierend und zu später Stunde auch philosophierend – zu zweit, aber auch oft mit Besuchern–, haben sich die beiden hier ihren individuellen Genusskosmos erschaffen.


Von Tanninen und Krumen
Zum Beispiel das Brot. Jahrelang waren sie auf der Suche nach einem wirklich guten Brot und fanden es dann endlich vor vier Monaten in Adelboden in der Bäckerei Haueter, die ihre Teige vor dem Backen mindestens 48 Stunden lang führt. Jetzt galt es nur noch auszutüfteln, wie ein Brot, das in Adelboden gebacken wird, in Fläsch genauso knusprig auf den Tisch kommt. Die Lösung: Die Brote werden in Adelboden genau 20 Minuten lang bei 180 Grad gebacken, danach in Alufolie eingepackt und nach Fläsch geschickt. Hier werden sie dann in den Folien nochmals 90 Minuten bei 160 Grad fertig gebacken. Und genau so steht es jetzt frisch gebacken vor uns. Und plötzlich diskutieren wir nicht mehr über Säure und Tannin, sondern über die Krumenstruktur, über den weichen, inneren Teil des Brotes. Die Geschichte, wie Gantenbeins zu den besten eingemachten Tomaten aus Italien kamen, ist übrigens ebenso abenteuerlich. Nur so viel sei gesagt: Seit sie diese Tomaten gefunden haben, importieren sie eigenhändig eine ganze Palette für den Eigengebrauch in die Schweiz. Ja, man muss halt schon ein bisschen verrückt, zumindest aber radikal sein, wenn man dahin kommen will, wo Martha und Daniel Gantenbein heute stehen.
Und, wo stehen sie heute? Jeder Abend, den die Gantenbeins mit Gästen verbringen, wird diesbezüglich zur schonungslosen Standortbestimmung. «Burgund versus Gantenbein» heisst meistens die Versuchsanordnung, natürlich verdeckt, alle Weine werden hier prinzipiell aus Karaffen kredenzt. An diesem Abend ist der subtilfrische Chassagne Montrachet Premier Cru Morgeot 2002 von Marc Morey gegenüber dem 2002er Chardonnay der Gantenbeins leicht im Vorteil, doch schon ihr 2004er wird sich gegenüber dem 2004er Meursault von J.F. Coche-Dury als ebenbürtig erweisen. Und spätestens gegen Ende des Abends, beim grossen, aber friedlichen Pinot-Showdown, liegen die Vorteile dann beim 95er Gantenbein, obwohl der mit keinem Geringeren als dem 95er Clos de la Roche Grand Cru der Domaine Dujac auf den Tisch kommt.
Unterbrochen wird dieses burgundisch-fläscherische Freundschaftsspiel durch Kreationen wie Saku-Thon-Tartar, mariniert mit Zitronenöl (Huilerie St. Michel, Menton), Zitronenzeste, Panch-Phoron-Gewürzmischung, in Essig eingelegtem Ingwer und Sojasauce. Dazu gibt’s Wakame-Algen mit Zitronenöl, geröstetem Sesam und Sherry-Essig. Garniert wurde der Algensalat mit «Serum 12», dem Aceto des deutschen Gewürzgurus Ingo Holland. Von diesem übrigens führen die Gantenbeins ein beeindruckendes Arsenal an Gewürzen und Pasten, untergebracht in zwei grossen Schubladen. Der zweite Gang, «Bio-Scampi aus den vietnamesischen Mangroven-Sümpfen auf Sauerkraut mit Crème fraîche», mutet gegenüber dem ersten Gang vergleichsweise einfach an, und spätestens beim Hauptgang, «Angusrind-Schulterbraten mit Schmorgemüse», kehrt Daniel Gantenbein dem Pinot Noir zuliebe («der Chardonnay erlaubt eher eine kleine Extravaganz») zur puren Klassik zurück.
Die Suche nach dem Besten

Mit allem begonnen haben Gantenbeins 1980. «Damals waren wirk napp 20 Jahre alt und wussten eigentlich nur eines: dass wir künftig nicht mehr als Angestellte, fremdbestimmt von irgendwelchen Vorgesetzten, weiterleben wollten», erinnert sich Martha Gantenbein. Mit einem Kredit und wenigen Rebparzellen gründeten sie das Projekt Gantenbein. In den ersten Jahren unterschied sich ihr Betriebskonzept nicht gross von dem der anderen Herrschäftler Winzer. «Wir wollten gut sein, wussten aber noch nicht, was gut überhaupt ist», erzählt Martha Gantenbein. Erst Ende der 80er Jahre wurden sie selbstbewusster, begannen zu reisen und knüpften Kontakte zu anderen Winzerpersönlichkeiten wie Alois Kracher, Paul Fürst oder Paul Draper. Das waren entscheidende Begegnungen. «Um wirklich weiterzukommen, mussten wir für uns selbst eine individuelle Vorstellung von dem entwickeln, was einen grossen Chardonnay oder Pinot ausmacht. Und diese Vorstellung kannst du dir eben nicht im stillen Kämmerchen erarbeiten, sondern nur in der ständigen Auseinandersetzung mit anderen Weinen und anderen Winzern.»
1993 stellten sie komplett von Stahltank- auf Barrique-Ausbau um, seit 1995 filtrieren sie ihre Weine nicht mehr. Zudem bestockten sie zwischen 1986 und 2008 sämtliche Parzellen neu mit dem nach ihren Erkenntnissen besten Klonmaterial. Absoluter Qualitätsanspruch, gekoppelt mit einem gesunden Pragmatismus, das ist ebenso ein zentraler Aspekt ihres Erfolges wie ihr Mut zur Reduktion. Während andere Winzer immer neue Sorten und Selektionen auf den Markt brachten, gingen sie radikal den entgegengesetzten Weg.


Wird «bio» der nächste Schritt?
Das Renommee der Gantenbeins beruht heute auf einem einzigen Chardonnay und einem einzigen Pinot Noir. Damit diese beiden Weine mit jedem Jahrgang das Prädikat «State of the Art» verdienen, söndern sie ihre Reben bis zu achtmal vor der Ernte. Und damit sie mit dem Nichtfiltrieren keine bösen Überraschungen erleben, wird jede einzelne Barrique analysiert (oft auch mehrfach), um sicherzustellen, dass der biologische Säureabbau wirklich zu hundert Prozent abgeschlossen ist. Mit 55 (Martha) und 53 Jahren (Daniel) sehen sich die Gantenbeins noch lange nicht am Ende ihres Weges. Und dabei denken sie nicht nur an Finetuning. Ihr nächstes grosses Ziel: ohne Einbussen in Bezug auf Qualität und die ohnehin schon bescheidene Menge künftig auf den Einsatz von synthetischen Mitteln im Rebberg weitestgehend zu verzichten. Bei den Insektiziden ist ihnen das schon gelungen, der nächste Schritt wäre der Verzicht auf Herbizide. Werden die Gantenbein-Crus womöglich in zehn Jahren kontrolliert biologisch abgefüllt? Darauf festlegen will sich das Winzerpaar nicht, aber immerhin: Die Frage beschäftigt die beiden intensiv.
Die Runde übrigens klingt aus mit der Nr. 27 Versteigerungs-Auslese 1989 von Egon Müller. Diesem perfekten Riesling stellen die Gantenbeins kein eigenes Gewächs gegenüber. Und so endet der Abend irgendwie, wie er begonnen hatte: mit einem Champagner Egly-Ouriet V.P. Grand Cru Extra Brut, der über 70 Monate auf der Hefe reifte. Grosse Winzer, die einem auch gleich noch Crus von anderen grossen Winzern kredenzen, sind schon sehr, sehr sympathisch.