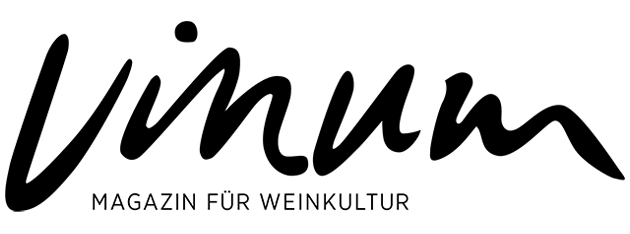Schweizer Crus
Schweizer Crus, die Geschichte schrieben
Text: Thomas Vaterlaus

Aussergewöhnliche Winzer keltern aussergewöhnliche Weine. Hier die Geschichte von sechs Gewächsen, welche die Schweizer Weinszene in höchst positiver Weise verändert haben: auch oder gerade weil es Weine sind, die bewusst gegen den Mainstream und manchmal auch gegen fragwürdige gesetzliche Bestimmungen angebaut und gekeltert worden sind.

Der aufmüpfige Comte
Jean-Daniel Schlaepfer und Gérard Pillon | Genf
Die Revolutionäre haben ihr Feld geräumt. Gérard Pillon starb 2012 tragisch bei einem Autounfall. Von Jean-Daniel Schlaepfer, dem charmanten Enfant terrible der Schweizer Weinszene, wissen sie in der Domaine des Balisiers nicht mal mehr die Telefonnummer. Der inzwischen 67-Jährige lebe jetzt in einem Stadthaus in Sevilla, sei aber im Moment gerade in Vietnam unterwegs. Geblieben ist der Comte de Peney, der erste Cabernet-Blend in der Schweiz. Und eine unglaubliche Geschichte: Schlaepfer studierte 1968 in der Flower-Power-Metropole Berkeley, wurde Rechtsanwalt in Genf, traf wegen eines Gerichtsfalls den Spengler Pillon und gründete mit ihm 1983 die Domaine des Balisiers. Sie starteten ihr Weingut-Projekt mit einem Feuerwerk an Innovationen, die ihre geistig trägen Nachbarn als Provokationen verstanden. Etwa der kontrolliert biologische Anbau oder die Lyra-Erziehung, die mehr Photosynthese und damit eine bessere Reife garantieren sollte. Und zusammen mit dem französischen Rebbauforscher Alain Carbonneau fanden sie heraus, dass die klimatischen Bedingungen in Satigny ähnlich sind wie in jenen Teilen der Loire, wo der Cabernet Sauvignon charaktervolle Weine ergibt. 1986 pflanzten sie die damals noch nicht zugelassene Sorte in ihrer Domäne an. Zu viel für die eh schon aufgeheizte Stimmung in der Genfer Weinszene.
Mehrmals standen die Balisiers-Mitarbeiter morgens vor Traktoren mit aufgeschlitzten Pneus. «Winzer-Kollegen» denunzierten Schlaepfer und Pillon wegen ihrer Cabernet-Aktion. Die Polizei fuhr auf, und die beiden mussten die Cabernet-Stöcke wieder ausreissen. Schlaepfer erstritt sich das Recht, den Cabernet Sauvignon in Genf anpflanzen zu dürfen, schliesslich vor Gericht. Im Verfahren ist die hirnrissige Aussage eines Experten der Forschungsanstalt Changins protokolliert, der behauptete, der Cabernet Sauvignon werde in der Schweiz niemals ausreifen.
1993 landete der 1990er Comte de Peney bei einer gross angelegten Probe in Zürich mit Cabernets aus aller Welt auf dem dritten Platz und schlug dabei auch den einen oder anderen Premier Cru aus Bordeaux. Bis heute hat der Comte, eine Cuvée aus circa 70 Prozent Cabernet Sauvignon und 30 Prozent Cabernet Franc, die in Toneiern und gebrauchten Barriques ausgebaut wird, nichts von seiner Klasse verloren. Die Domaine des Balisiers übrigens wird heute von Nathanaël Schlaepfer und Christophe Pillon geführt, den Söhnen der beiden Gründer.

Im Namen des Grossvaters
Giorgio Rossi | Tessin
Ja, ja, die Bondola. Seit der fremde Merlot die Rebberge im Tessin in politisch ausgedrückt schon fast totalitärer Weise kolonisiert hat, schreit kaum noch ein Hahn nach der alteingesessenen Sorte, diesem «Ticinese vero». Eigentlich erstaunlich, dass im Tessin noch niemand eine Initiative gegen die Masseneinwanderung fremder Rebsorten gestartet hat… Aber eben die Bondola hatte offensichtlich nie einflussreiche Fürsprecher, zu stark haftet ihr das bäuerlich-rustikale Image an. Auch heute sind die meisten Tessiner Winzer der Meinung, die Sorte tauge allenfalls zur Herstellung eines leichten Rosé-Weines für heisse Sommertage. Einer aber denkt völlig anders. Giorgio Rossi hat als Kind noch erlebt, wie sein Grossvater die Bondola-Trauben mit eigenen Füssen im Holzbottich stampfte, um seinen Nostrano herzustellen, der neben Bondola auch Barbera, Bonarda und Freisa enthielt. Das war noch in der guten alten Zeit der Mischwirtschaft, in der man sich eigenen Trockenschinken, eigenen Wein und selbst gebrannten Grappa mit eingelegten Kräutern gönnte oder auch gönnen musste.
Seit 1993 pflegt Giorgio Rossi im atemberaubend steilen Gelände hoch über dem Dorf Sementina die inzwischen 80-jährigen Bondola-Stöcke seiner Familie. Den ehemaligen Hof hat er in eine kleine, aber feine Hightech-Kellerei umfunktioniert. Im Jahr 1995 hatte er die Idee, aus diesen Bondola Vieilles Vignes einen besonderen Wein zu keltern. Eine Hommage an seinen Grossvater. Den Bondola del Nonu Mario, der nach einer behutsamen, eher kurzen Maischegärung – denn bei zu starker Extraktion entstehen sofort störende, vegetal anmutende Tannine – für ein Jahr in gebrauchten Barriques reift. So entsteht ein gehaltvoller Bondola, der trotzdem immer noch den ursprünglichen Charakter der Sorte erkennen lässt, weil er eben nicht «auf Teufel komm raus» auf Fülle getrimmt wird. Ein zarter Duft nach roten Beeren und Veilchen und eine stets beschwingte Frische zeichnen diesen Wein aus. Selbst im Tropenjahr 2003 wies der Bondola del Nonu Mario nur gerade 12,5 Volumenprozent Alkohol und eine immer noch stolze Säure von 5,5 Gramm auf. In den letzten Jahren hat Giorgio Rossi den Holzeinsatz bei seinem Top-Bondola etwas reduziert. Im Zeitalter der Klimaerwärmung müsste die Sorte eigentlich eine Renaissance erleben, doch dem ist bislang leider nicht so. Der Cru aus den 80-jährigen Stöcken ist bis heute ein bewundernswerter Einzelfall.

Mit Steilpass vom Jaeger
Waldemar und Niklaus Zahner | Zürich
Das zürcherische Truttikon liegt nur gerade zehn Kilometer von der Stadt Schaffhausen entfernt, doch mit der legendären «Fischerzunft» von André Jaeger konnten die Zahners lange Zeit herzlich wenig anfangen. «Das war für uns einfach so einer, der ausländisch kocht und dazu ausländische Weine ausschenkt», sagt Niklaus Zahner, der den Betrieb damals mit seinem Vater Waldemar führte. Dann, Ende der 80er Jahre, besuchte der Spitzenkoch die Zahners. Diese fragten ihn, was sie denn um Herrgotts willen nur tun müssten, um es mit einem Wein auf die Weinkarte der «Fischerzunft» zu schaffen. Jaeger hatte eine Idee. «Wenn ihr einen in der Barrique ausgebauten Pinot Blanc in die Flasche bekommt mit einer ähnlichen Stilistik wie derjenige von Franz Keller in Oberbergen am deutschen Kaiserstuhl, nehme ich ihn sofort auf die Karte.» Weil der Anbau des Pinot Blanc damals aber im Kanton Zürich noch verboten war, zögerten die Zahners. Doch Jaeger liess nicht locker. Zwei Jahre später kam er wieder, mit drei oder vier Barrique-Weissburgundern im Gepäck, und forderte nach dem gemeinsamen Degustieren die Zahners auf, endlich «Nägel mit Köpfen» zu machen. So beschafften sie sich also 1500 Pinot-Blanc-Reben im Elsass und pflanzten sie.
Der Zürcher Rebbaukommissär bekam über Mittelsmänner Wind von der Sache, doch die damals schon gut vernetzten Zahners erhielten die notwendige Sonderbewilligung auch nachträglich problemlos. Einzige Auflage: Von jedem Jahrgang musste eine Kiste zwecks Qualitätskontrolle in die Forschungsanstalt in Wädenswil gesandt werden. «Wir waren eigentlich der Meinung, zwei Flaschen sollten dafür reichen, sie verlangten aber ausdrücklich deren zwölf», erinnert sich Zahner.
Als der erste Wein fertig im Fass lag, kam André Jaeger wieder auf Besuch, zusammen mit drei Küchenchef-Kollegen. Die vier bestellten nach dem Verkosten der ersten Truttiker Pinot-Blanc-Barrique-Fassprobe gleich 3000 der insgesamt 3400 Flaschen. Seither ist das Gewächs der allseits geschätzte Hauswein in der Schaffhauser «Fischerzunft». Das ehrt die Gäste dieses Hauses beziehungsweise deren Weingeschmack. Denn dieser Pinot Blanc ist keines jener belanglosen Weinchen, die man unter diesem Sortennamen leider auch findet, sondern ein finessenreicher Cru nach burgundischem Vorbild. Und auch die Zahners sind happy: Sie denken schon lange nicht mehr schlecht über den Mann mit den «fremdländischen Kochideen».

Ein Freund namens Robert
Alain Paley | Waadtland
Am 20. August 1953 bekam der Winzer Pierre Paley in Epesses hohen Besuch. Eine Delegation des Waadtländer Landwirtschaftsdepartements inspizierte seinen Rebberg. Am 18. Januar 1955, also eineinhalb Jahre später, hatten die behördlichen Mühlen endlich ein Briefchen «gemahlen», in welchem dem Winzer beschieden wurde, dass es sich bei seinem Gamay nicht um den empfohlenen offiziellen Klon, sondern um den Typ Robert handle, wahrscheinlich eine lokale Mutation. Darum dürfe er von diesen Reben keinesfalls Stecklinge an andere Winzer oder Baumschulen weitergeben. Er selber immerhin, so gütig waren die Herren, durfte die Rarität weiter anbauen. Als Paley in den 60er Jahren seine Parzelle infolge des Autobahnbaus aufgeben musste, wären die letzten Robert-Stöcke wohl verschwunden, hätte der Winzer Robert Monnier aus Cully entgegen dem kantonalen Erlass nicht doch Stecklinge gezogen und diese vermehrt. In den folgenden Jahren wurde der Plant Robert unter anderem in den Rebbergen der Commune de Cully angebaut und der daraus gekelterte Wein exklusiv in der weitherum bekannten «Auberge du Raisin» in Cully ausgeschenkt, was ihm allmählich einen legendären Ruf bescherte.
Heute wird die Sorte wieder von rund 20 Weinbaudomänen kultiviert, die Anbaufläche dürfte demnächst zehn Hektar erreichen. Eine 2002 gegründete Vereinigung wacht darüber, dass die Renaissance der Sorte konsequent qualitätsorientiert vor sich geht. So finden wir in den Plant-Robert-Weinen heute die Trinkigkeit und Frische eines klassischen Gamay bei spürbar mehr Struktur und Ausdruck. Mit diesen Eigenschaften trifft der Plant Robert den Nerv der Zeit wie kaum eine andere Rotweinsorte in der Westschweiz. Eine Auswahl von vorzüglichen Plant-Robert-Crus bietet übrigens noch immer die «Auberge du Raisin» in Cully an. Und auch die Familie Paley, der wir das Überleben dieser Sorte verdanken, hält die Tradition hoch. Alain Paley, der Enkel jenes Mannes, der einst den letzten Plant-Robert-Rebberg besass, keltert noch immer den Robaz. Der Name, der sich mit «Räuber» übersetzen lässt, entspricht dem einstigen Übernamen der Sorte in der Gegend von Epesses. Es ist ein im Stahltank ausgebauter Wein, in dem wir bei moderaten 13 Volumenprozent Alkohol alle guten Eigenschaften dieser Sorte finden. Vor allem aber ist es ein Wein, von dem man gerne eine zweite Flasche trinkt.

Der «Räuschlingologe»
Hermann Schwarzenbach | Zürich
Der Räuschling und die Schwarzenbachs, das ist eine ganz besondere Liebesbeziehung. Selbst in den Nachkriegsjahren, in denen der Riesling-Silvaner in Mode kam, hielten sie am Zürcher Urwein fest. Die Selektionsarbeit von Hermann Schwarzenbach III. (1921 bis 2011) bildete die Grundlage zur heutigen Renaissance der Sorte, als deren Vorreiter «Stikel» Schwarzenbach (auch Hermann IV. genannt) gilt. Heute werden in der Reblaube zu Meilen insgesamt Räuschling-Trauben von rund zwei Hektar eingekellert. Kein anderer Betrieb in Zürich, der Schweiz und im Rest der Welt kann einen ähnlich hohen Räuschling-Anteil ausweisen. Daraus werden nicht weniger als fünf verschiedene Räuschlinge vinifiziert.
Der Basis-Räuschling ist ein überaus trinkiger Klassiker mit geradliniger, erfrischender Säure, während die beiden Lagen-Selektionen Mariafeld und vor allem die Seehalde vielschichtiger und reichhaltiger ausfallen. Die Auslese mit belebendem Spiel zwischen Säure und dezenter Restsüsse orientiert sich am Modell des feinherben Rieslings.Und der R3 schliesslich, die Selektion aus drei verschiedenen Terroirs (Sandstein, Ton und kieseliger Kalk), ist eine Gemeinschaftsproduktion mit den Weingütern Lüthi in Männedorf und Rütihof in Uerikon. Die Reichhaltigkeit der Topweine Seehalde und R3 beruht auf einer minuziösen Rebbergsarbeit, die auf kleinbeerige, gleichmässig gereifte Trauben abzielt. Raritätenproben, wie sie die Schwarzenbachs unter anderem 2008 und 2013 organisierten, beweisen das eindrückliche Alterungspotenzial des Räuschlings. Noch im Alter von hundert Jahren kann er mit edlen Tertiäraromen, die an Sherrys erinnern, und einer völlig intakten, von der Säure lebendig gehaltenen Struktur begeistern. Nur in den 60er und 70er Jahren entstanden auch bei den Schwarzenbachs unter der verhängnisvollen «Wädenswil-Doktrin» einige Räuschling-Jahrgänge mit kastrierter Säure und entsprechend beschränkter Lebensdauer.
Inzwischen wurde dieser Fehler längst korrigiert. Trotzdem darf man gespannt sein, welcher Räuschling-Typ sich denn bei künftigen Schwarzenbach-Raritätenproben als derjenige mit dem interessantesten Reifepotenzial erweisen wird. Die etwas zur Fülle neigenden Weine Seehalde und R3, die Auslese oder womöglich doch der geradlinige Klassiker? Übrigens, die Schwarzenbachs bieten in ihrer Reblaube einige gereifte Räuschlinge zum Kauf an, unter anderem die Jahrgänge 1983, 1985, 1987 oder 1995.

Gallischer Zaubertrank
Josy Chanton | Wallis
Seit weltweit bekannte Rebforscher wie Carole Meredith von der UC Davis in Kalifornien und José Vouillamoz mittels DNA Analysen zum Schluss gekommen sind, dass es sich beim Gwäss (auch Heunisch oder Gouais genannt) um die älteste bekannte Rebsorte der Welt handelt, stellt sich die Frage, wie um Himmels willen diese Ursorte ausgerechnet im Oberwallis heimisch geworden ist. Josy Chanton, der charismatische Hüter und Anwalt der Ursorten im obersten Teil des Rhonetals, glaubt, dass der römische Kaiser Marcus Aurelius Probus dieses Gewächs wohl im dritten Jahrhundert nach Christus zu den Galliern brachte, um dort den Weinanbau zu fördern, unterwegs wohl aber einige Stöcke im Wallis liess. Nun war der Gwäss ein echter Playboy, gilt er doch als Miterzeuger von unzähligen Edelsorten, darunter Riesling, Chardonnay oder Gamay.
Im Wallis jedoch führte er kein glamouröses Leben. Im Mischsatz angebaut, brachte er gelinde gesagt herbe oder auch nur derbe Weine hervor. Mit ein wenig über 45 Grad Öchsle geerntet, hatte er kaum mehr Alkohol als heute ein kräftiges Bier, dafür eine horrende Säure, welche immerhin bei schwerer körperlicher Arbeit für die nötige Erfrischung sorgte. Als Josy Chanton vor genau 30 Jahren begann, den Gwäss sortenrein zu keltern, war ihm der Spott sicher. «Am besten kaufst du Fässer mit innen montierten Metallreifen, damit es wegen der Säure die Fassdauben nicht nach innen zieht», sagte einer. Ein anderer prognostizierte ihm Weine, die so sauer seien, dass es «dir die Unterhose zwischen den Arschbacken reinzieht».
Durch die Umstellung von den ehemaligen Buschreben auf besser durchlüftete Drahtrahmenerziehung und konsequente Ertragsbeschränkung ernten die Chantons heute ihren Gwäss mit 75 bis 80 Grad Öchsle, was einen bekömmlichen Wein zwischen 10,8 und 11,5 Volumenprozent Alkohol und trotz malolaktischer Gärung eine Säure zwischen fünf und sechs Gramm ergibt. Es ist ein geradliniger, frischer, aber ausgewogener Wein mit zitrusfruchtigen und kräuterwürzigen Noten. Durch seine jahrelange Pionierarbeit hat Josy Chanton bewiesen, dass sich im Oberwallis niemand mehr vor dem Gwäss zu fürchten braucht. Darum wird die älteste Sorte der Welt und somit höchstwahrscheinlich auch die älteste Sorte im Oberwallis hier nun wieder auf einem Hektar angebaut. Mehrere Produzenten bringen jährlich zusammen rund 3000 Flaschen auf den Markt.