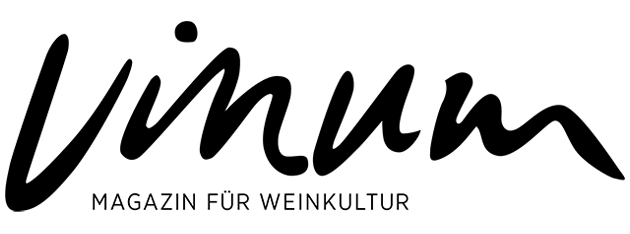Stationen der Weingeschichte
Stilschule

Wie ein Weinstil entsteht, wie man ihn schmackhaft macht und wie man ihn am Leben erhält: über die Chianti-Formel und andere Weinrezepte.
Am Anfang steht der Ertrag. Fällt er zu hoch aus, radiert er jeden Unterschied weg. Ist er zu tief, passiert das Gleiche, zur Überraschung aller Parker-Jünger. Wein wird auswechselbar und stillos. Stilvoll heisst: Mein Erzeugnis ist anders als alle anderen. Stil ist Voraussetzung für Marke. Unter der Bedingung allerdings, dass «anders» dem Kunden mundet. Wer sich durch Fehlgeschmack unterscheiden will, hat die falschen Karten.
Stil beginnt mit Farbteint, Alkohol- und Gerbstoffgehalt und endet beim daraus resultierenden Geschmack, Aroma und der Harmonie des Ganzen. Für die Franzosen kommt Stil vom Terroir. Es muss so karg sein, dass die Erträge nicht zu hoch ausfallen, gut Wasser abführen, im Fall von Trockenheit die Rebe dennoch mit Feuchtigkeit versehen und so die optimale Reife möglichst langsam fördern, damit sich Aromenauslöser ideal entwickeln. Und: Terroir enthält, gemäss der Mischung aus Empirik und Mystik, mit der Winzer seit Jahrtausenden werkeln, die ganze Mikroflora und -fauna, die für eine gute Gärung sorgt (genau jene, der sie seit 50 Jahren mit immer reaktiverer Chemie den Kampf ansagen).
Hält Terroir nicht, was es verspricht, hilft man einfach nach: Ein Weinrezept aus dem 15. Jahrhundert (dessen Quelle mir leider abhanden gekommen ist – für Hinweise bin ich dankbar) will, dass zur Maische auch wilde Beeren, Taubenmist, ein toter Hund und ungelöschter Kalk gegeben werden. Der tote Hund soll wohl die Mikroorganismen liefern (Pasteur «erfindet» die Gärung erst 1857) und der Kalk sie danach gleich wieder killen. Beigaben zum Haltbar machen des Weins (mehr denn zum Aromatisieren) sind überhaupt gang und gäbe: Schon die alten Griechen harzen ihren Wein.
Seltsamerweise wird die Wahl der richtigen Sorte in der Weingeschichte erst relativ spät zum Stilmittel erhoben. Sicher, Burgunderherzog Philippe II. will den «untreuen Gaamez» 1395 aus dem Burgund entfernt haben, weil er nur mittelmässige Weine ergebe – doch wissen wir wirklich, was sich hinter diesem Sortennamen versteckt?
Reben werden nach dem Zufallsprinzip benannt, und angepflanzt wird häufig das, was die Rebschule eben vorrätig hat. Darum tauchen Sortennamen erst im 19. Jahrhundert als Stilelement auf, meist nach der Reblauskrise, die den ganzen alten, über Jahrhunderte selektionierten und vermehrten Rebbestand vernichtet. In Châteauneuf-du-Pape etwa experimentieren Winzer mit alten einheimischen Sorten, die sie mit aus Spanien importierten ergänzen.
Joseph Ducos, Besitzer von La Nerthe, notiert sorgfältig die Eigenschaften jeder Varietät. Und ab dem 20. Jahrhundert wird der Sortenmix (Châteauneuf, der Wein aus 13 Sorten) zum wichtigsten PR-Argument. Zwar findet nur mehr ein Bruchteil dieser Sorten Einlass in einen modernen Châteauneuf, der fast ausschliesslich aus Grenache und Syrah besteht. Doch an der Mär der 13 Sorten, denen der Wein seine Komplexität und Harmonie verdanke, wird hartnäckig festgehalten.
Genauso wie an der Story des Bettino Ricasoli, der als Erfinder der «Chianti-Zauberformel» gilt, nachdem er in einem Brief festhält, dass der optimale Blend aus den roten Sorten Sangiovese und Canaiolo sowie weissem Malvasia bestehe. Letztere sind praktisch aus dem Rebsatz verschwunden und werden durch Cabernet und Merlot ersetzt. Modernes Weinmarketing mag Sortenweine – als Chianti-Erfinder wird der «eiserne Weinbaron» jedoch bis heute gefeiert.